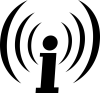Linksextremismus
Es ist der Volkssport linksextremistischer Gruppen: Mitglieder der rechten Szene bloßzustellen und sie im Internet zu öffentlichen Personen zu machen. Persönlichkeitsrechte sprechen sie ihren „Outing-Opfern“ ab. Die Devise lautet: „den Nazis das Leben zur Hölle machen“.
Von Katharina Iskandar
Als die Gruppe am Abend im hessischen Biblis eintrifft, sind die Straßen mit Schnee bedeckt. Der Wind ist eisig, es herrschen minus vier Grad. Es ist die Nacht zum 24. Dezember 2010. Die Nacht zu Heiligabend. Es sind drei Personen, die in der Dunkelheit durch den Ort laufen. Vom Bahnhof aus spazieren sie durch das Wohngebiet. Vorbei an Einfamilienhäusern mit Vorgarten. Wen sie auf der Straße treffen, dem drücken sie einen Zettel in die Hand. Hunderte haben sie dabei. Genug für die ganze Nachbarschaft.
„Wir tolerieren keine Nazis! Weder hier, noch anderswo“, steht auf den Zetteln. Daneben das Flaggen-Symbol der „Antifa Biblis“, die bis dahin völlig unbekannt war. Auf dem Flugblatt ist ein junger Mann zu sehen. Florian W. Zwanzig Jahre alt. Wohnhaft in Biblis. Er soll der führende Kopf der „Nationalen Sozialisten Ried“ sein. „Ein Nazi“, so steht es auf dem Flyer.
Noch in derselben Nacht wird die Nachricht ins Internet gestellt: „Florian W. geoutet“, steht auf der Internetseite „Indymedia.org“. Dort wird spekuliert, auf welchen Demonstrationen Florian W. sonst noch gesehen worden ist. Es werden weitere Bilder ins Netz gestellt; auch solche, von denen selbst der Einsteller nicht sicher ist, ob es sich überhaupt um Florian W. handelt. Am nächsten Morgen klingelt bei Florian W. das Telefon. Im Internet heißt es wenig später dazu, man habe soeben einen „Testanruf“ gemacht – und herausgefunden, dass Florian W. noch bei seinen Eltern wohnt.
An die Telefonnummer ist der Anrufer über das Flugblatt gelangt. Denn sowohl die Festnetz- als auch Handynummer sind in dem Steckbrief veröffentlicht. Ebenso wie Geburtsdatum, ICQ-Nummer, SchülerVZ-Account und sein Name bei „Wer kennt wen“. Es ist kurz nach zwei Uhr morgens in der Nacht zu Heiligabend, als Florian W. zu einer öffentlichen Person wird.
„Nazi-Outings“ sind zum Volkssport in der linksextremistischen Szene geworden
Die Aktion im hessischen Biblis ist nicht die einzige dieser Art. Bundesweit versuchen linksextremistische Gruppen, tatsächliche oder auch vermeintliche Personen aus der rechten Szene bloßzustellen, indem sie ihre mutmaßliche politische Gesinnung, aber auch intime Daten per Flugblätter in der Nachbarschaft und im beruflichen Umfeld verbreiten – und im Internet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet derartige Aktionen schon seit mehreren Jahren.
„Nazi-Outings“ sind zum Volkssport in der linksextremistischen Szene geworden. Persönlichkeitsrechte sprechen sie ihren „Outing-Opfern“ ab. Personen aus dem rechten Milieu hätten kein Recht auf Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit, lautet das Argument. Das gilt auch für Personen, die nur mutmaßlich der rechten Szene angehören. Straftaten, die aufgrund von Outings stattfinden, werden toleriert. Wenn nicht gar durch die Veröffentlichung von Wohnort, Autokennzeichen oder Arbeitsplatz forciert und in gewisser Weise auch gefordert.
Die Outing-Aktionen haben System. In Hamburg gab es 2009 die „Operation Ragnarök“. Innerhalb von acht Wochen wurden sechs Personen „geoutet“, die zur rechtsradikalen Szene zählten. Ragnarök ist ein Begriff aus der altgermanischen Mythologie – und steht für den Weltuntergang. Wieder wurde über das Internet kommuniziert. Die Devise lautete, „den Nazis das Leben zur Hölle machen“.
Der Pranger im Netz bleibt bestehen
Am Morgen des 29. August suchten Mitglieder der Hamburger Antifa-Szene die Wohnhäuser zweier NPD-Anhänger auf und informierten mit Megafonen, Transparenten und Flugblättern die Nachbarschaft. Solche „Home Visits“ sind immer noch üblich. Jedoch verlagern sich die Outings immer stärker ins Internet und entwickeln dort wie im Fall Florian W. eine Eigendynamik. Während der „Hausbesuch“ oft eine einmalige Aktion ist, bleibt der Pranger im Netz bestehen. Zudem wurden die Methoden, solche Outings vorzubereiten, gerade in jüngster Zeit nahezu perfektioniert.
Es werden Dossiers angelegt über Anhänger rechtsradikaler Gruppen. Das gilt inzwischen auch für Personen, die mit ihnen verwandt oder bekannt sind oder von denen man bloß annimmt, dass sie dieser Szene angehören. In den oft virtuell geführten Akten befinden sich Bilder. Einige Zielpersonen werden Monate, andere Jahre lang observiert. Sie werden heimlich bei Demonstrationen fotografiert oder aber im sozialen Umfeld.
Zudem werden nicht nur „offizielle“ Daten wie Geburtsdatum, Wohnort, Arbeitgeber oder Autokennzeichen bekanntgemacht, sondern auch Namen von Ehepartnern, Kindern, getrennt lebenden Ehepartnern und neuen Lebensgefährten. Lebensläufe werden so detailliert wiedergegeben, dass sich die Energie, die hinter der Informationsbeschaffung gesteckt haben muss, oft nur erahnen lässt.
Woher die Antifa ihre Informationen über die jeweiligen Zielpersonen bezieht, ist selbst für die Sicherheitsbehörden nicht immer nachvollziehbar. Es gibt Hinweise, dass sie „Spitzel“ in die rechte Szene schleusen, die Informationen über Personen sammeln und weitergeben. Außerdem werden soziale Netzwerke durchforstet. Die Autonome Antifa Freiburg, die einer der umtriebigsten „Outing“-Aktivisten in Deutschland ist, nennt das „klassische Recherchearbeit“.
Polizei und Verfassungsschutz sehen die Outings äußerst problematisch
Die Bespitzelung hört dort aber nicht auf. Die Linksextremisten bedienen sich mittlerweile vor allem technischer Möglichkeiten, um ihre Dossiers zu füllen. So wurde in mehreren Fällen auch privater E-Mail-Verkehr veröffentlicht, was aus Sicht der Sicherheitsbehörden darauf schließen lässt, dass man sich Zugang zu den E-Mail-Accounts der Zielpersonen verschafft haben muss.
Dies geschieht möglicherweise durch Schadsoftware, die sich die Aktivisten als fertige Ausspäh-Programme illegal beschaffen und mittels Trojaner auf die Computer des jeweiligen Outing-Opfers spielen. Dazu braucht es noch nicht einmal spezielles technisches Knowhow. Oder aber tatsächlich durch fundierte Computer-Kenntnisse. Die Autonome Antifa Freiburg spricht von „Social Engineering-Angriffen“ und einer „produktiven Kooperation mit der Daten-Antifa“. Die rühmt sich im Internet mit „Hacker-Angriffen“, gibt eine ganze Reihe von „gehackten Nazi-Portalen“ an, die oft auch im Zusammenhang mit Manipulationen von rechten Internetseiten stehen.
Polizei und Verfassungsschutz sehen die Outings äußerst problematisch. Und das mehr denn je. Denn im Zusammenhang mit diesen Aktionen stehen nicht selten weitere Straftaten. Extremismus, heißt es, dürfe nicht durch Extremismus bekämpft werden. Denn damit gehe zwangsläufig eine Umgehung des Rechtsstaats einher, weil die Methoden, die angewandt werden, selbst wieder Straftaten generierten. Dass zudem gerade die Autonomen Antifa-Gruppen, die sich selbst nicht auf dem Boden des Grundgesetzes bewegten, sich in einer Art Selbstjustiz als Aufklärer aufspielten, gilt als Gefahr.
Zum Teil schwerwiegende Folgen
Zudem beklagen vor allem Verfassungsschützer, dass nach solchen Outings die Chance, jemanden aus der rechten Szene für ein Aussteigerprogramm zu gewinnen, um ein Vielfaches sinkt – das ist besonders bei Jugendlichen problematisch, die mit 15 oder 16 Jahren etwa über den Freundeskreis in die rechte Szene reinrutschen, zwei oder drei Jahre später dann aber wieder aussteigen – weil sich die „Peer Group“ oder die sonstigen Lebensverhältnisse geändert haben. Für diese Jugendlichen könnten derartige Outings zum Teil schwerwiegende Folgen haben, heißt es in den Behörden, die Aussteigerprogramme anbieten. „Zum Beispiel, dass sie auch die letzten Bindungen an die Zivilgesellschaft verlieren.“ Im schlimmsten Fall könnten Outings aus Sicht der Verfassungsschützer auch das „Freund-Feind-Denken“ fördern, was sich wiederum in massiven Straf- und Gewalttaten entladen kann.
So wie in Hamburg. Im vergangenen Jahr wurden dort auf Internetportalen mehrere Akteure der rechtsextremistischen Gruppierung „Freie Nationalisten Berlin Mitte“ dargestellt, Bilder von Angehörigen veröffentlicht und ihre Namen und Wohnadressen genannt.
Am 11. August wurde eine Flasche mit Farbe in das Wohnzimmer eines Rechtsextremisten in Berlin-Friedrichshain geworfen – kurz nachdem der Mann im Internet als Neonazi „geoutet“ worden war. Zwei Wochen später schlugen Linksextremisten eine Person, die sie in der rechtsextremistischen Szene vermuteten, vor ihrem Wohnhaus nieder. Im Internet erschien der Kommentar: „Selbstjustiz für die gute Sache.“
Am 15. Oktober setzten Linksextremisten ein Auto in Brand, das sie dem mutmaßlichen Anführer der „Freien Nationalisten Berlin Mitte“ zuschrieben. Kurz darauf wurde ein Selbstbezichtigungsschreiben veröffentlicht. Darin gaben die Täter kund: „Wo Nazis auftauchen, werden wir sie und ihre Autos angreifen. Es gibt kein ruhiges Hinterland.“
Wie sich später herausstellte, gehörte das Auto einer Verwandten der eigentlichen Zielperson.