Interview: Johannes Supe
Am Wochenende traf sich die Mitglieder der Interventionistischen Linken, IL, um die künftige Strategie des Verbands zu besprechen. Das Resultat der Konferenz haben Sie in einer Pressemitteilung so zusammengefasst: »Die radikale Linke kann keine Linke der Themen, sondern muss eine Linke der Situation sein.« Was soll das heißen?
Viele Menschen setzen sich derzeit in Bewegung, gehen in Konfrontation zum System. Etwa jene, die in Solidaritätsinitiativen für Geflüchtete aktiv sind. Sie verstehen nicht, warum ein Deutschkurs, den sie geben wollen, nicht zustande kommt, nur weil kein Geld für einen Raum da ist. Wenn die radikale Linke sich hier Gehör verschaffen will, dann muss sie flexibel sein. Sie darf nicht einfach bei ihren bisherigen Themenblöcken wie Antifaschismus und Klimawandel bleiben. Das meinen wir, wenn wir von einer Linken der Situation sprechen.
Das klingt, als wollten Sie nur noch reagieren, statt selbst Schwerpunkte zu setzen.
Im Gegenteil. Gerade jetzt ist es wichtig, nicht nur zu reagieren. Doch die radikale Linke bleibt bei ihren eigenen Themen stehen. Wir sind etwa unglaublich gut darin, einen Naziaufmarsch zu verhindern, wir beteiligen uns an Aktionen gegen den Kohleabbau. Aber der Diskurs wird bestimmt vom neoliberalen Block und von Nazis.
Vielleicht sind die Felder, in denen die radikale Linke derzeit »unglaublich gut« ist, einfach nicht jene, die eine Masse von Menschen mitreißen?
Zur Zeit gibt es fast nichts Notwendigeres, als konsequent antifaschistisch zu sein. Wir müssen aber schauen, mit wem wir zusammenarbeiten. Aus Ländern wie Griechenland, Spanien oder der Türkei können wir zum Beispiel lernen, wie man mit Menschen gemeinsam kämpft, die sich gegen Zwangsräumungen stellen. Dabei kommt es darauf an, was die Leute bewegt. Das fassen wir unter dem Begriff der neuen Gesellschaftlichkeit, die wir brauchen. Um dem Moment der sozialen Spaltung – etwa wenn Obdachlose gegen Geflüchtete ausgespielt werden – etwas entgegenzusetzen, brauchen wir aber eine eigene Erzählung, ein linkes Narrativ.
Vor zwei Wochen haben wir Sie schon einmal interviewt, es ging um Proteste gegen einen Berliner Naziaufmarsch. Da drückten Sie sich klar aus. Jetzt werfen Sie mit Begriffen wie »Linke der Situation« oder »linkes Narrativ« um sich. Warum so schwurbelig?
Tatsächlich ist auch die Situation sehr komplex. Aber nehmen Sie einmal den Aufmarsch, den Sie angesprochen haben. Bei den Protesten dagegen sind auch Antifaschisten auf die Straße gegangen, die noch nicht zur radikalen Linken gehören. Mit ihnen müssen wir sprechen. Schaffen wir das, könnte ein linker Pol entstehen. Wir brauchen dazu aber auch mehr Ereignisse, solche wie Blockupy oder Dresden nazifrei. Sie ermöglichen es den Menschen, die bereits eine Wut auf das System aufgebaut haben, gemeinsam auf die Straße zu gehen.
Sie wollen sich also auf große Events fokussieren. Was ist aber mit der kleinteiligen Arbeit, die Menschen im Betrieb oder im Wohnviertel zu organisieren?
Die Frage ist falsch gestellt. Denn Blockupy fand doch nicht nur am 18. März 2015 statt. Schon vier Jahre davor fanden sich hier Linksradikale zusammen, aber auch Leute, die anfingen, sich zu politisieren. Und mit Blockupy entstand ein Akteur. An vergangenen Wochenende waren etwa Menschen von Blockupy in Paris, um mit den Aktivisten dort zu sprechen. Da wurde gemeinsam überlegt, welches Ereignis sich als nächstes schaffen ließe. Auch war Blockupy der Ausdruck einer offensiven linksradikalen Politik – und ein Symbol gegen die Angst. Viele Menschen haben derzeit Angst, sei es vor einem Rechtsruck oder vor der sozialen Spaltung. Angst ist aber ein Gefühl, kein Themenfeld.
Das Wort »Bewegung« scheinen Sie zu mögen, Themen hingegen weniger. Wie wäre es denn mit dem Satz: »Die Bewegung ist alles, das Ziel ist nichts.«
Nein. Wenn wir von den großen Begriffen sprechen – Freiheit, Gleichheit, Kommunismus –, dann haben wir auch ein Bild im Kopf, dass etwas anderes tatsächlich möglich ist. Eine Welt ohne Traurigkeit, ohne Wettbewerbsdruck und Sparzwang. Das sind die Dinge, die uns antreiben, wenn wir auf die Straße gehen. Die wollen wir nicht über Bord werfen.
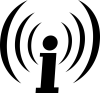
Scheiß IL
Scheiß Populisten
HIER...
sollte man mal ansetzen!
http://kritisch-lesen.de/rezension/leerstelle-der-biodeutschen-antifa