Der Schwarze Block ist kein Verein, keine Partei, kein Bündnis, nicht einmal eine Gruppe. Er ist der linksextremistische Schwarm, der mit Moral und Militanz auf Polizisten losgeht.
Der erste Pflasterstein ist immer der schwerste. Um ihn aus dem Untergrund zu lösen und auf einen Polizisten zu werfen, benötigt man ein Stück Metall, einen Schraubenzieher oder eine Brechstange, so hart ist der Fugensand meist über die Jahre geworden. Ist der erste Stein aber herausgelöst, seien die anderen kein Problem, sagt Hannah aus Frankfurt, die schon als Schwarzvermummte an Demonstrationen teilgenommen hat. „Man kann sie dann einfach heraushebeln.“ Das eigentlich Problematische an einem Pflasterstein aber ist sein Gewicht, die zehn mal zehn Zentimeter großen Granitbrocken müssen mit großer Wucht geworfen werden, wenn sie einen etliche Meter entfernten Block von Polizisten oder einen Wasserwerfer treffen sollen. „Wenn von hinten Pflastersteine geworfen werden, treffen die nicht selten die eigenen Leute in den ersten Reihen. So etwas passiert ständig“, sagt Hannah.
Der fliegende Pflasterstein ist in Deutschland zu einem Symbol geworden für die Gewaltbereitschaft radikaler Gruppen. Fliegende Pflastersteine und Brandsätze sind ein Grund, warum Polizisten mittlerweile auf Demonstrationen auftreten wie Profispieler einer Footballmannschaft, mit dicken Polstern, Schonern und Helmen. In der autonomen Szene werden sie dafür als „Robocops“ oder „Playmobilmännchen“ verlacht, gefürchtet und verflucht, auch mit dem jahrzehntealten Reim: „Zwischen Bullenhelm und Nasenbein passt immer noch ein Pflasterstein.“ Das Bundesamt für Verfassungsschutz schätzt, dass in Deutschland 6600 „gewaltbereite Autonome“ leben, das sind Menschen, die „Anwendung von Gewalt – auch gegen Personen – zur Durchsetzung ihrer Ziele für legitim halten“, heißt es. So exakt diese Definition scheinen mag, so wenig ist sie eine Antwort auf die Frage, was ein Mensch für wahr erachten muss, um diesen allerersten Stein aus dem Boden zu kratzen und zu werfen. Ebenso wenig ist sie eine Antwort auf die Frage, wer diese 6600 Menschen eigentlich sind.
Der Schwarze Block ist aber kein Verein. Er ist keine Partei, kein Bündnis, nicht einmal eine Gruppe. Im Grunde ist er nicht mehr als eine Kleiderordnung. Junge Männer und Frauen vermummen ihre Gesichter mit Sonnenbrillen und Schirmmützen, sie tragen schwarze Pullover, schwarze Hosen, manchmal auch ein schwarzes Tuch über Mund und Nase.
Die Geschichte des Schwarzen Blocks geht auf das Jahr 1980 zurück, als eine Gruppe von Anarchisten und Autonomen sich in Frankfurt diesen Namen gab und in der Innenstadt die Glasscheiben von Banken und Geschäften zerstörte. Über Jahrzehnte war der Schwarze Block ein Phänomen der linksradikalen Szene. Mittlerweile gibt es den Schwarzen Block auch unter Rechtsextremisten, die bei Aufmärschen nicht nur im Erscheinungsbild ihren Erzfeinden gleichen, sondern in der Gewaltbereitschaft und im moralischen Überlegenheitsgefühl. Für beide Enden des politischen Spektrums hat die Vermummung allein ein Ziel: Sie diene der Tarnung, um auf Polizeivideos nicht identifizierbar zu sein und „militante Aktionen“ durchführen zu können, wie Hannah und Tom sagen. Ob sie dabei schon Steine geworfen haben, sagen die beiden nicht. Warum Gewalt aus ihrer Sicht legitim sein kann, hingegen schon.
„Ich erkenne das Gewaltmonopol des Staates nicht an“, sagt Tom. „Der Staat setzt damit Sachen um, die dem widersprechen, was ich unter einer guten Gesellschaft verstehe. Die Gewalt, die wir bei Demonstrationen ausüben, ist nur die praktische Entsprechung der Politik.“ Dabei ist das Denken in Monopolen auch Tom nicht fremd, er beansprucht eines in moralischer Hinsicht. Der – aus seiner Sicht – zutiefst bürgerliche Einwand, in einer Demokratie sollte eine Minderheit ihre Interessen nicht mit Zwang durchsetzen, beeindruckt Tom nicht. Er sieht sich als Teil einer Avantgarde. „Die Linke war immer für Modernisierungen der kapitalistischen Verwertungskette zuständig.“
Nach Ansicht des Direktors des Bochumer Instituts für soziale Bewegungen, Stefan Berger, sind solche Sätze, historisch betrachtet, ein Rekurs auf den Avantgarde-Gedanken von Lenin. „Danach weiß die Avantgarde des Proletariats besser, wie die Probleme der Gesellschaft zu lösen sind, als das Proletariat selbst. Deshalb ist die Avantgarde sogar berechtigt, gegen den Willen der Mehrheit vorzugehen, weil die Mehrheit ein falsches Bewusstsein haben könnte.“ Ein Ausdruck dieses Gedankens sei ein Liedtext von Louis Fürnberg aus dem Jahr 1950: „Die Partei, die Partei, die hat immer recht“, erklärt Berger. Auch Hannah sagt Sätze, die nach Lenin klingen: „Ich kann der parlamentarischen Demokratie nichts abgewinnen.“ Es gebe innerhalb der verfassungskonformen Meinungsbildung „keine Gestaltungsmöglichkeiten“, weil ihre (linksradikalen) Forderungen im parlamentarischen Prozess von den Mehrheitsführern „ausgesiebt“ würden.
Andere formulieren solche Ansichten noch vehementer. Auf der Internetseite black-block.de lobt ein Aktivist das Gewaltpotential der Szene: „Im Handlungsdiskurs zwischen Linksradikalen und Staatsmacht bildete sich tatsächlich der Eindruck, dass Steinewerfen und Autos abzufackeln nützlich sein kann.“ Und in einer Rede während einer Demonstration am 2. Oktober 2003 in Bad Homburg sagte ein Aktivist der Antifaschistischen Initiative Heidelberg zu schwarz vermummten Demonstranten: „Dummheit muss mit militanter Aufklärung entgegengetreten werden; funktioniert auch dies nicht, muss dies mit aufklärender Militanz geschehen . . . Menschliche Emanzipation kann es nur gegen Deutschland geben. Kapitalismus abschaffen! Deutschland auflösen!“ In einem Bericht des baden-württembergischen Verfassungsschutzes wird diese Rede als ein Beleg für die staatsgefährdende Tendenz der autonomen Szene verstanden.
Um das Café Gegendruck zu finden, einen Treffpunkt der autonomen Szene, muss man in der Heidelberger Altstadt in eine Seitengasse laufen und an einem Wohnhaus klingeln. In einem Raum im Erdgeschoss, in dem alte Sofas und Tische stehen, finden Benefizpartys für angeklagte Aktivisten statt, Spieleabende von Antifa-Mitgliedern und kleine Kinovorführungen. Um einen Holztisch herum sitzen vier Veteranen des Schwarzen Blocks an einem Holztisch. In der Mitte ein langhaariger Mann in schwarzem T-Shirt, der laut einer Polizeiakte, die er ironisch zitiert, eine „Führungsperson der antifaschistischen Szene des Rhein-Neckar-Kreises“ und in der Roten Hilfe engagiert ist, einer Organisation, die Linksradikale in Strafverfahren unterstützt. Neben ihm sitzt ein kräftiger Mann mit Tätowierungen, der als Lehrer arbeitet und einen schlafenden Säugling auf dem Arm trägt. Schließlich noch ein sportlicher Mann, der sagt, er sei Journalist und eine schlanke Frau, die Germanistik in Heidelberg studiert hat. Ihre Namen wollen die vier Aktivisten nicht nennen, weil sie auch über Straftaten sprechen.
Die Wände ihres Cafés sind mit Flugblättern beklebt, darunter auch Fotos von „Simon Brenner“, einem verdeckten Ermittler des baden-württembergischen Landeskriminalamtes, der sich unter falschem Namen in die linksradikale Szene eingeschlichen hatte und enttarnt wurde. Es herrscht ein Untergrundgefühl bei den Heidelberger Aktivisten, sie fühlen sich von der Staatsmacht beobachtet, verfolgt – und leiten daraus ihre Berechtigung zum Widerstand ab.
In mehreren Jahrzehnten haben die Heidelberger
Aktivisten schon viele „Aktionen“, wie sie sagen, durchgeführt. Einen
Reisebus von Neonazis mit besonders übelriechender Buttersäure
unbenutzbar gemacht. Ein Geschäft der unter Rechtsextremen beliebten
Modemarke Thor Steinar mit Farbbeuteln beworfen. Und Skinheads, die ein
Punkkonzert stürmen wollten, in ihren Heimatdörfern mit Stuhlbeinen
verprügelt. Ihre Definition eines Schwarzen Blocks als
Demonstrationstaktik ist das „entschlossene, kämpferische Auftreten“ im
Gegensatz zu einem „Sonntagsspaziergang am AKW“. Einer sagt:
„Leserbriefe schreiben ist nicht meine Art von Politik.“ Dass die
Öffentlichkeit empört ist, wenn nach einer Demonstration etwa die
Glasfassade eines Bankhauses in Scherben liegt, kontern die Heidelberger
Aktivisten mit einer Parole, die bisweilen auch auf Demonstrationen zu
hören ist: „Menschen sterben und ihr schweigt, Scheiben klirren und ihr
schreit.“ Mit den gestorbenen Menschen sind dabei die Opfer von
Rassismus und Krieg gemeint. Ein anderer sagt: „Zu sagen, dass Gewalt
völlig tabu ist, finde ich dumm.“
Hannah und Tom versuchen, die
Gefährlichkeit der Steinwürfe zu relativieren. „Die Panzerungen der
Polizisten sind doch unzerstörbar, ich kann mir nicht vorstellen, dass
das weh tut“, sagt Tom.
In Wirklichkeit bringt der Regen aus Steinen und Flaschen nicht nur Polizisten, sondern auch Demonstranten in Lebensgefahr. Steffen Dopichay, ein Abteilungsleiter der Berliner Bereitschaftspolizei, hat erlebt, wie ein Molotow-Cocktail in einen Funkwagen der Polizei geworfen wurde. Er hat gesehen, wie Linksradikale einen Feuerlöscher und eine Gehwegplatte von einem 30 Meter hohen Hausdach in die Menge warfen. Abschätzen, wo die Gegenstände landen würden, konnten sie vom Dach aus nicht. Die Steinplatte traf einen Polizisten an der Schulter, der schwer verletzt zusammenbrach. „Hätte der Stein ihn wenige Zentimeter weiter am Kopf getroffen, wäre der Kollege tot gewesen“, sagt Dopichay, der auf Demonstrationen den Einsatz mehrerer Hundertschaften leitet. Der Feuerlöscher schlug wenige Meter neben einer Gruppe von Passanten auf dem Asphalt auf. Bei den schon zur Tradition gewordenen Ausschreitungen am 1. Mai in Berlin klappte eine 23 Jahre alte Polizistin ihr Visier hoch, um frische Luft zu schnappen. Sie wurde von einer geworfenen Flasche am Kiefer getroffen. Ihr Kiefer brach, sie verlor mehrere Zähne. „Dabei war das, in Anführungszeichen, nur eine Flasche“, sagt Dopichay.
Er selbst hat sich daran gewöhnt, auf Demonstrationen bespuckt und als „Nazischützer“ und „Bullenschwein“ beschimpft zu werden. Kürzlich schüttete ihm ein Demonstrant einen Becher heißen Kaffee ins Gesicht.
Auf solche Erzählungen von
Polizisten reagieren Vertreter der linksradikalen Szene üblicherweise
mit einem Schulterzucken und sprechen über Opfer von Polizeigewalt in
den eigenen Reihen. Schuld an Ausschreitungen sei einzig der „aggressive
Korpsgeist“ der Polizisten, sagt Hannah, die Polizei betreibe eine
„Eskalationspolitik“ und freue sich auf Prügeleien mit dem Schwarzen
Block, sagen die Heidelberger Aktivisten. Die Beamten könnten die Härte
ihrer Maßnahmen meist nicht einschätzen. Nur wenige Beamte wüssten, wie
sich Pfefferspray anfühle, und sie seien bei Festnahmen ungewollt grob,
weil sie unter der Schutzkleidung kein Feingefühl hätten, sagen die
Aktivisten. „Die Rede von den gewaltbereiten Autonomen ist ein Mythos
der Polizei. Bei den meisten Demonstrationen, auf denen der Schwarze
Block vertreten ist, passiert nichts“, sagt einer der Heidelberger. Der
Schwarze Block sei eine Reaktion, keine Aktion.
Auf Internetseiten kursieren Hunderte Videos, in denen Demonstranten von Polizisten geschlagen werden. Die Szenen sind martialisch. Einem wenig wehrhaften Demonstranten wird während einer Verhaftung angeblich ein Schädelbruch zugefügt. Polizisten schlagen einen Autonomen, der sich bereits im Haltegriff eines anderen Beamten befindet. Andere sprühen Pfefferspray in eine Menge von Demonstranten und treffen dabei Personen, denen angeblich kein Fehlverhalten zur Last gelegt werden kann. Nachprüfbar sind solche Fälle nur, wenn es zu einem Strafverfahren kommt, was nach Meinung der Autonomen selten ist, weil Polizisten in vielen Bundesländern, anders als in Berlin, keine individuellen Kennzeichen tragen. Unabhängig von ihrer Beweiskraft führen die Videos aber zu einem regelrechten Hass auf die Bereitschaftspolizei, besonders die Berliner Einheiten, die unter Autonomen als brutal gelten.
„Polizisten haben kein Problem damit, uns ordentlich auf die Fresse zu hauen. Ich bin in meinem Leben schon so oft demütigend behandelt worden von Polizisten. Wenn ein Polizist einen Stein abbekommt, ist das sicher doof für ihn, aber in dem Moment sehe ich ihn in der Funktion, die er hat, und das ist die Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols mit allen Mitteln“, sagt Hannah. Es ist ein kühler Gedanke, einen Menschen auf seine Funktion zu reduzieren und seine Verletzung mitleidlos in Kauf zu nehmen. Der Frankfurter Sozialpsychologe Rolf van Dick findet solche Argumente gefährlich, weil sie einer „Deindividuation“ Vorschub leisten, einer Entmenschlichung. „Man betrachtet die andere Gruppe nur noch als Gruppe. Und die ist der Feind. Es gibt keine Wahrnehmung des Individuums mehr und kein Gefühl von Mitleid“, sagt van Dick. Um diesen Effekt zu vermeiden, setzen Polizisten nach Auskunft von Kommissar Stoewhase ihre Schutzhelme erst auf, wenn Steine fliegen, um so lange wie möglich hinter der Panzerung ein menschliches Gesicht zu zeigen.
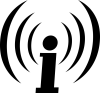
Man man man...
Wer sich freiwillig in eine Befehlskette begibt ist kein Subjekt mehr. Er/Sie/* wird Befehlsempfänger_in und verdinglicht sich somit selbst. Die Ausübung von Autorität und Gewalt aufgrund von Befehlen ist so ziemlich das abscheulichste, was Menschen mit ihrer "Freiheit" so anstellen können. Bull_innen ist VOR ihrer Ausbildung ihre Rolle völlig bewusst. Befehle empfangen und geben ist genauso wie die Ausübung von Gewalt ALLTAG. Dementsprechend muss mensch bestimmte Charakterzügen haben, die ganz klar unter den "autoritären Charakter" subsumiert werden müssen. Wer sich also freiwillig in eine solche Position begibt, hat jede Menschlichkeit SELBST aufgegeben...