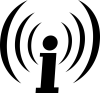Strategien der Neuen Rechten für das Jahr 2013, Teil I.
Nationalkonservative bemühen sich um mehr Einfluss innerhalb und außerhalb der CDU/CSU. Bisher allerdings mit überschaubarem Erfolg.
Von Volker Weiss
Das extrem rechte Milieu hadert einmal mehr mit dem derzeitigen Parteiensystem. Das zeigte sich während des Skandals um die Deutsche Burschenschaft. Die Burschenschaftlichen Blätter publizierten einen Revolutionsaufruf des korporierten Historikers Michael Friedrich Vogt zur Überwindung des »Parteienstaats«. In dem noch unter der »Schriftleitung« des jetzt abgewählten Norbert Weidner (Jungle World 49/2012) erschienenen Verbandsorgan befand sich Vogt in bester Gesellschaft. In derselben Ausgabe ließ sich Claus-Michael Wolfschlag, ein Autor der Jungen Freiheit (JF), über die »Ex-Kommunistischen Kadergruppen« innerhalb der Grünen aus, der CDU-Rechtsdissident Ralph Weber verfasste einen Beitrag zu seinem Dauerthema: »Brauchen wir eine Partei rechts der CDU?«
Der Widerspruch zwischen Ablehnung und Neugründung politischer Parteien hat in der Rechten Tradition. Selbst in Zeiten mächtiger Rechtsparteien wie DNVP oder NSDAP blieb die Zerschlagung des Parteiensystems das Ziel. Der Gedanke der Mitbestimmung und des Aushandelns politischer Entscheidungen stand der Grundüberzeugung der Rechten entgegen: der aus der Ungleichheit resultierenden Notwendigkeit straffer Führung.
Heute stehen die Nachfolger dieser Strömungen vor einem Dilemma: Einerseits teilen auch sie die Ablehnung von Parteien als einer korrumpierenden Konzession an die Mechanismen der ungeliebten Massendemokratie. Andererseits steht dem die Erfahrung entgegen, dass sich Politik in Deutschland über Parteien organisiert. Wer Veränderung will, braucht ein Instrument parlamentarischer Teilhabe. Das Wahljahr 2013 gibt Anlass, die rechte Debatte über eine parteipolitische Sammlung zwischen CDU und NPD Revue passieren zu lassen.
In der Krisendiagnose sind sich Rechte zumeist einig: »Deutschland schafft sich ab« – durch falsche Sozial- und Familienpolitik, mangelnden Glauben und die Preisgabe »nationaler Souveränität« an Europa. Dagegen helfen sollen Deregulierung und »Staatsverschlankung«, eine wirtschaftspolitische Orientierung am Mittelstand, die Eindämmung von Migration und die familien- und bildungspolitische Umkehr. Dass der »Marxismus« als klassischer Feind kaum mehr vorkommt, liegt daran, dass die Gesellschaft in dieser Lesart quasi eine marxistische ist. Das erklärte Feindbild sind die Achtundsechziger, deren »Kulturrevolution« als Ursache allen Übels angesehen wird und revidiert werden soll. Zur Frage, wie dies zu bewerkstelligen sei, gibt es grob umrissen zwei konkurrierende Positionen: die Unterstützung einer nicht etablierten Partei oder die Hoffnung auf einen Rechtsschwenk einer etablierten Partei, deren Erfahrung und Infrastruktur effektiver genutzt werden könnten.
Die Förderung einer noch nicht etablierten rechtspopulistischen (Klein-)Partei war in der Vergangenheit beliebt, als sich abwechselnd die Republikaner, der »Bund Freier Bürger« und die Schill-Partei der Sympathien etwa der JF erfreuten. Wohlwollend begleitet werden heute auch Gruppen wie die »Pro-Bewegung« oder die Partei »Die Freiheit« um den CDU-Renegaten René Stadtkewitz. Dass sich die Sarrazin-Debatte aber von diesen nicht ausmünzen ließ, bereitete der JF einiges Kopfzerbrechen. Obgleich rechts ein nicht unerhebliches Wählerpotential vorhanden ist, scheitert ein parteipolitischer Neuanfang vor allem daran, dass auf weiter Flur derzeit kein charismatisches Personal in Sicht ist. Vielleicht ist es ein Zeichen dieser Verlegenheit, dass derzeit vor allem die »Freien Wähler« die Aufmerksamkeit der JF bekommen. Diese ehemals regional agierende mittelständische Wählervereinigung, die ausgeprägte Vorbehalte gegen die EU hat, bereitet sich inzwischen auf einen Einzug in den Bundestag vor.
Effektiver wäre es, einen bereits eingespielten Apparat zu übernehmen. Im Fall der Unionsparteien wäre dies die Wiederaneignung von verlorenem Terrain, spiegelt sich doch in ihnen der Verlust der kulturellen Deutungshoheit des Konservatismus seit den siebziger Jahren besonders wider. »Politik ohne Überzeugung« heißt eine Broschüre des Instituts für Staatspolitik, die mit dem wirtschaftsorientiert-pragmatischen Erbe der Ära Kohl abrechnet. Denn bereits in dieser Zeit, so wird beklagt, fand die Liberalisierung statt. Die von Kohl versprochene »geistig-moralische Wende« sei, abgesehen von einigen geschichtspolitischen Attacken und »symbolischen Gesten«, ausgeblieben. Ebenso fand die erhoffte »nationalkonservative Wende« nach der Wiedervereinigung nicht statt. Zugunsten der europäischen Integration seien sogar die letzten Bastionen des Grenzrevisionismus und der Vertriebenenpolitik geschliffen worden. Dennoch hat man die Hoffnung auf ein Wiedererstarken einer Rechten innerhalb der CDU nicht aufgegeben. In der JF fand vor allem die Kampagne »Linkstrend stoppen« besondere Beachtung, mit der der CDU-Rechtsaußen Friedrich-Wilhelm Siebeke im Januar 2010 dem vermeintlich urban-liberalen Kurs von Angela Merkel entgegenwirken wollte.
Die Zeiten sind aber für eine ultrakonservative Politik nicht sehr vielversprechend: Leitfiguren der JF wie Martin Hohmann oder Jörg Schönbohm sind von Angela Merkel kaltgestellt worden, die Brandenburger CDU-Fraktionsvorsitzende Saskia Ludwig verlor nach einem Beitrag für die JF in diesem September ihren Posten. Norbert Geis (CSU) wurde in seinem Wahlkreis von der Vorsitzenden der Frauen-Union ausgestochen. Angesichts dieser Lage haben diesen Herbst mittelständische Rechtskonservative in der CDU als »Wahlalternative 2013« dazu aufgerufen, bei der kommenden Bundestagswahl für die »Freien Wähler« zu stimmen. Lange erwartet wurde das »Konservative Manifest« des »Berliner Kreises« in der CDU um Wolfgang Bosbach. Als es schließlich im November vorlag, wurde klar: Bis dato hat man sich kaum wirkungsvoll organisiert, wesentliche Programmpunkte sind auf innerparteilichen Druck hin aus dem Dokument verschwunden. Es handle sich um ein »Dokument der Niederlage«, beschied die Welt. Für einen Kurswechsel in der CDU stehen die Zeichen schlecht. Selbst die jüngste Ablehnung der steuerlichen Gleichstellung homosexueller Paare ist kaum mehr als ein symbolischer Akt.
Dennoch sucht man über etablierte rechte Basisbewegungen wie sogenannte Lebensschützer, Vertriebenenverbände und das Verbindungsmilieu die CDU unter Druck zu setzen. Auf dem »Großen Konservativen Kongress« Anfang Mai 2011 in Berlin wurde die Tea-Party-Bewegung als Vorbild für eine außerparlamentarische Einflussnahme auf eine große Partei genannt. Allerdings ist es zweifelhaft, ob sich die Verhältnisse des US-amerikanischen Konservatismus auf Deutschland übertragen lassen. Mittlerweile steht auch fest, dass in den USA diese Taktik den Republikanern geschadet hat.
Seit der Bundestagswahl 2009, als enttäuschte CDU-Wähler sich der FDP zuwandten, keimen immer wieder Hoffnungen auf eine Renaissance des Nationalliberalismus. Einige aus der neurechten Strömung stehen in wirtschaftlichen Fragen dem Neoliberalismus näher als einem klassisch-protektionistischen Sozialkonservatismus. Hinzu kommt die Ablehnung der Euro-Politik auch in der FDP. Als Vorbild für die Umwandlung einer liberalen Partei gilt die österreichische FPÖ, die unter Haider einen scharfen Profilwechsel erfuhr. Mehrfach pries die JF auch andere europafeindliche rechtspopulistische Parteien: die Schweizer SVP, die Venstre in Dänemark, VVD und PVV in den Niederlanden und Fidesz in Ungarn. Allerdings repräsentiert derzeit noch Philipp Rösler die FDP – und nicht Alexander von Stahl. Angesichts dessen ist es kein Wunder, dass im politischen Feld zwischen dem rechten Flügel der CDU und der NPD die Parteienfeindlichkeit steigt und verstärkt metapolitische Optionen erwogen werden.