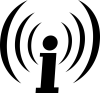Interview Ständig steigende Mieten sind kein Naturgesetz, sagt der Soziologe Andrej Holm. Es brauche aber den politischen Willen zur Veränderung
der Freitag: Herr Holm, wer Berlin länger kennt, hat erlebt, wie die Stadt ihr Gesicht verändert hat. Alles, was runtergekommen war, ist nun gestrichen. Ist doch eigentlich schön, oder?
Andrej Holm: Ja, ist ganz schön, aber es gibt da einen gedanklichen Kurzschluss: Wir denken, es wird teurer, weil es schön wird. Doch es ist genau umgekehrt: Es wird schön, damit es teuer werden kann. Kein Eigentümer würde ohne staatliche Finanzierung irgendein Haus sanieren, wenn er damit nicht höhere Erträge und Gewinne erzielen kann. Das ist der Mechanismus des Kapitalismus: Geld wird investiert, um sich zu vermehren, die Veränderung der Stadt ist nicht das Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck.
Geht das überhaupt anders?
Stadtentwicklung ist eine ständige Veränderung und Preissteigerungen sind kein Naturgesetz. Berlin zum Beispiel hat mit der Einwanderung aus süd- und osteuropäischen Ländern in den 1960er Jahren sein Gesicht massiv verändert, ganz ohne dass es dadurch zu Mietsteigerungen gekommen ist.
Nennen wir mal ein Beispiel für einen Gentrifizierungskonflikt. Anfang März in Kreuzberg: Nachts kommen schwarz gekleidete Männer und zerdeppern bei einem Restaurant mit Eispickeln die Scheiben. Die Besitzerin, eine lesbische Frau aus New York, dachte, sie könnte in Berlin unbehelligt leben und wundert sich. Was ist da schiefgelaufen?
Vielleicht haben die Zeitungen zu häufig darüber geschrieben, dass neue Kneipen, Galerien und Bioläden die eigentlichen Urheber von Gentrifizierung sind. Aber das ist nur die Oberfläche der Veränderung. Eigentlich müssten wir darüber reden, wie neue Investitionsmodelle aussehen und warum die Deutsche Wohnen als größtes deutsches Wohnungsunternehmen mit einem sehr institutionellen Anlageansatz immer mehr Wohnungen in Berlin erwerben kann. Gentrification hat im Kern wenig mit Lebensstilen zu tun. Sie ist Folge von politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen.
Sie kritisieren, dass Wohnraum genauso zum Wirtschaftsobjekt wird wie gefrorener Orangensaft.
Wohnen ist nicht einfach ein typisches Marktgut, wie es uns die neoliberalen Wirtschaftswissenschaften erklären wollen. Es geht nicht nur um Angebot und Nachfrage, sondern um eine Spekulation mit künftigen Ertragserwartungen. Die Mieten steigen nicht, weil es mehr Konkurrenz um Wohnraum gibt, sondern weil Eigentümer höhere Mieten aufrufen. Zudem haben sich Grundstücke und Wohnungen als Finanzanlage etabliert. Das erzählen uns die Sparkassen und die Deutsche Bank, die wollen, dass wir in Immobilien anlegen. Und das machen die internationalen Investoren, die Wohnungen an der Börse handeln.
Gibt es denn ein Recht darauf, dass die Dinge so bleiben, wie sie waren? Wenn wir von den Kiezprojekten sprechen – da sammeln sich oft Leute, die wollen, dass ihr Viertel so bleibt, wie sie es kennen. Ein legitimes Interesse?
Ich glaube, dass das ein Missverständnis ist. Ganz viele Menschen engagieren sich seit Jahren mit, die Viertel so zu gestalten, dass sie gern in ihnen leben. Kritisiert werden ja nur die Veränderungen, die an den eigenen Bedürfnissen vorbeigehen. Wir können die Frage auch umkehren: Gibt es ein Recht, mit den Lebens- und Existenzbedingungen von anderen sehr viel Geld zu verdienen? Gibt es ein Recht, die Innenstadt zur Verwertungsmasse zu machen? Wir könnten auch denjenigen sagen, die Betongold schürfen, geht dorthin, wo ihr niemanden stört. Baut dort eure Neubauwohnungen, wo die Reichen dann einziehen können.
Was passiert mit einer Stadt, wenn Leute keinen Wohnraum mehr finden?
Im Moment haben wir in Berlin die Situation, dass es in den Innenstadtbezirken mit einer armen Bevölkerung und extrem steigenden Mieten viele Haushalte gibt, die sogar zu arm sind, verdrängt zu werden. Die finden nicht mal in Spandau oder Marzahn eine neue Wohnung, die sie sich leisten können. Kompensatorische Überbelegungen sind die Folge und auch Untervermietungen. Bei einem Großteil dieser skandalisierten Airbnb-Untervermietungen geht es nicht um professionelle Ferienvermietungen, sondern um Leute, die mindestens dreimal im Monat ein zusätzliches Einkommen brauchen, um ihre Miete zu bezahlen. Dann schlafen die in einer Laube und vermieten unter.
Also keine Umzüge mehr?
Wir beobachten gerade weniger eine Verdrängung durch Umzüge aus den Stadtteilen als vielmehr eine Verdrängung aus dem Lebensstandard. Je mehr die Menschen an Miete aufwenden müssen, desto weniger bleibt ihnen für alles andere. Wir haben also Familien, die es sich nicht mehr leisten können, die Schulbücher für ihre Kinder zu kaufen, ins Kino zu gehen oder in Urlaub zu fahren.
Wie wirksam ist Protest? Wie gut funktioniert es, sich zu wehren?
Wir haben in Berlin seit Jahren eine Reihe von fragmentierten Auseinandersetzungen von Hausgemeinschaften, die sich gegen Modernisierung und Verdrängung zur Wehr setzen. Die Erfahrung zeigt, dass sie dann eine Chance auf Erfolg haben, wenn es ihnen gelingt, von dem Einzelfall in eine politische Sphäre zu wechseln und zu sagen: Das ist ja nicht nur unser Problem, dass die Mieten steigen, dass unsere Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, dass unser Haus für einen Neubau abgerissen werden soll. Und immer dann, wenn es diesen politischen Überschuss gab, war es auch möglich, über gesetzliche Regelungen oder Zugeständnisse der Politik partielle Erfolge zu erzielen.
Ohne Protest geht es nicht ...
Wir sind in Berlin momentan in einer Situation, in der es gar keine Alternative gibt. Wir kennen alle diese riesige Differenz zwischen den Mietspiegelmieten und den Neuvermietungsmieten. Da wird oft fast das Doppelte verlangt. Das führt dazu, dass den Menschen, die in ihrer Wohnsituation bedroht sind, keine andere Möglichkeit bleibt, als zu protestieren. Insofern ist das auch nicht eine schöngeistige Betrachtung nach dem Motto: Lohnt sich der Protest überhaupt? Das kann man in vielen anderen lebensstilbetonten Bewegungen machen. Im Falle der Wohnung ist das eine Existenzfrage. Und das wird häufig übersehen, wenn sich Mittelschichtsangehörige über Städte unterhalten.
Was raten Sie denn konkret?
Den Wohnungsmarkt verändern kann man eigentlich nur, wenn die Möglichkeiten, mit Mietsteigerungen und Spekulation Geld zu verdienen, eingeschränkt werden. Eine höhere Grunderwerbssteuer würde etwa den massiven Spekulationshandel mit Wohngrundstücken erschweren. Ansonsten braucht die Stadt vor allem leistbare Wohnungen für Einkommen im unteren Bereich. Einfach nur Neubau wird da nicht reichen.
Kann man in einer Stadt den Neoliberalismus zurückdrängen?
Klar, dem scheinbar Alternativlosen kann immer etwas entgegengesetzt werden. Und damit haben wir in Berlin Erfahrung. Berlin ist nicht nur die Stadt des Mauerfalls, hier wurde in den 1980er Jahren auch die moderne Stadtplanung zurückgewiesen. Eine Stadtplanung, die alles abreißen und durch Neubauten ersetzen wollte. Es gab 130 besetzte Häuser in Westberlin – und dann wurde die behutsame Stadterneuerung eingeführt.
Haben Sie weitere Beispiele?
Wir können Großstädte im krisengebeutelten Spanien nehmen, die inzwischen von kommunalen Wahlplattformen regiert werden. In Barcelona ist eine Ex-Hausbesetzerin Bürgermeisterin, mit einem tollen Programm, bezahlbare Wohnungen zu bauen, Zwangsräumungen zu verhindern, die Immobilienwirtschaft einzuschränken.
Was kann man noch tun?
Städte brauchen eine umfassende Strategie, wie das Recht auf Wohnen gegen private Gewinninteressen durchgesetzt werden kann. Sie sollten sich ein Programm der Sozialisierung des Wohnens auf die Fahne schreiben. Wenn in den Zeitungen stehen würde: „Berlin wird sozialistisch“, hätte das zwar nichts mit der Realität zu tun, aber es würde bei der stimmungsabhängigen Immobilienindustrie den ein oder anderen Zweifel provozieren. Preise im Immobilienmarkt sind ja nicht real. Die sind davon abhängig, dass jemand glaubt, dass man hier viel Geld verdienen kann. Und wenn wir zeigen, dass es Protestbewegungen gibt, die das verhindern wollen, eine Verwaltung, die dem Steine in den Weg legt, und eine starke politische Führung – das würde einen Unterschied machen. Wir haben ja tolle Instrumente in der Verwaltung. Zum Beispiel eine Enteignungsbehörde ...
Die heißt wirklich so?
Das ist ein normales Stadtentwicklungsinstrument. Die enteignen etwa, wenn Straßen oder Flughäfen gebaut werden. Das Instrument selber ist aber auch für andere kommunale Zwecke nutzbar.