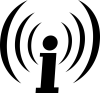Ein Forschungsfeld zwischen Feminismus und Kulturwissenschaft | Stefan Hirschauer
Der Begriff ‚Gender Studies‘ wird derzeit auf mindestens drei Weisen verwendet: als Bezeichnung eines transdisziplinären kulturwissenschaftlichen Forschungsgebietes, als beschwichtigende Umbenennung der feministischen Geschlechterforschung und als rhetorisches Mäntelchen für bürokratische Frauenfördermaßnahmen. Eine kritische Bestandsaufnahme aus soziologischer Sicht.
Der Sinn von ,Gender Studies’
In einem engen und präzisen Sinn bezeichnet Gender Studies die kulturwissenschaftliche Forschung zur Geschlechterdifferenzierung. Das wissenschaftliche Wissen über die Geschlechterdifferenz ist heute durch eine zweifache Paradigmendifferenzierung geteilt. Neben die ontologische Unterscheidung von sex und gender, die Natur- und Kulturwissenschaften trennt, ist eine epistemologische Differenz getreten: Die Geschlechterforschung verwendet Geschlecht als analytische Kategorie und empirische Variable, sie beobachtet Phänomene also mithilfe der Geschlechterunterscheidung und stellt so biologische Geschlechtsunterschiede oder soziale und sprachliche Ungleichheiten fest. Die Gender Studies dagegen beobachten diese Unterscheidung selbst als Phänomen, d.h. sie untersuchen, ob und wie eine Gesellschaft ‚Geschlechter‘ unterscheidet (wie sie es auch mit ‚Rassen’ tun oder lassen kann) – etwa in Geburtssituationen, sprachlichen Formen, Tätigkeiten, sozialen Beziehungen usw. Ihre Kernfächer sind die Geschichts- und Literaturwissenschaften, die Ethnologie und Soziologie, Erziehungswissenschaft, Linguistik und Wissenschaftsforschung. Diese Fächer haben gezeigt, dass Gender historisch und kulturell unabhängig von der biologischen Ausstattung menschlicher Männchen und Weibchen variiert – einschließlich der Zahl und des Zuschnitts von Geschlechtskategorien, die Gesellschaften vorsehen. Und sie haben eine neue grundlagentheoretische Vorstellung vom Geschlecht etabliert: Geschlecht besteht aus einer sozialen Praxis, die stattfindet oder nicht.
In der Gesellschaft stößt diese Einsicht auf tradierte alltagsweltliche Überzeugungen von der Natürlichkeit und Universalität des Geschlechtsunterschieds, die seit dem 19. Jahrhundert durch die Biologie geprägt wurden. Die Gender Studies haben deren alte Frage nach der Geschlechterdifferenzierung in eine kulturwissenschaftliche Grundlagenforschung überführt. Sie sind eine Wissenschaft von der Geschlechterunterscheidung, die mit den Naturwissenschaften um die Beantwortung der Frage konkurriert, was das Geschlecht überhaupt ist: eine natürliche Tatsache unserer Organ- und Zellstrukturen oder eine sinnhafte und historische Praxis, in die unsere Körper eingelassen sind. Was beide Unternehmungen teilen, ist die Suche nach den Grundlagen der Zweigeschlechtlichkeit – ob man sie nun in genetischen oder in kulturellen Codes sucht.
‚Geschlechter‘ bestehen in kulturwissenschaftlicher Sicht nicht bloß aus ein paar durch körperliche Tatsachen begrenzten Sozialisationseinflüssen, sondern aus einer historisch trägen Gemengelage aus Klassifikationspraktiken, kognitiven Schemata, sprachlichen Kategorien, Verhaltensgewohnheiten, Stereotypen, institutioneller Trägheit, Machtinteressen und diversen sich verstärkenden oder abschwächenden Bedingungskonstellationen. Wegen dieser Vielschichtigkeit ist diese soziale Konstruktion eine recht stabile Realität. Biologen können dem nur die Behauptung hinzufügen, dass dies auch notwendig und ewig so sein müsse. Dies ist für die Gender Studies nicht mehr als ein Datum, denn sie rekonstruieren auch biologische Forschungsergebnisse und Konzepte – nicht im Sinne von politisierender Wissenschaftskritik, sondern von empirischer Wissenschaftsforschung, die den Wandel biologischen Wissens begleitet und die Reflexivität dieser Fächer beträchtlich steigern kann.
Gender als rhetorischer Lack
Neben diesem präzisen Sinn von Gender Studies wird das Etikett aber auch noch anders verwendet: Zum einen ist ‚Gender‘ ein dünner rhetorischer Lack auf einer traditionellen Frauenforschung, die sich als feministische Gegenwissenschaft versteht. Sie ist im Wesentlichen Geschlechterforschung geblieben, die in der Feststellung sozialer Ungleichheit ihr Zentralthema hat. Zum anderen verschleift sich das Label ‚Gender‘ in einem politischen Etikettenschwindel: Auf der einen Seite tarnen sich mit ihm verzweifelte hochschulpolitische Versuche, hartnäckige Männerdomänen in bestimmten Fächern mit ‚Frauenprofessuren‘ aufzubrechen; auf der anderen Seite macht das sog. ‚Gender Mainstreaming‘ von Bürokratien die analytischen Gewinne des Konzeptes zunichte, indem es Personen unausgesetzt mit der Geschlechterunterscheidung beobachtet und ‚gendert’, ohne zu reflektieren, dass dies das Geschlecht beständig reproduziert, obwohl es doch einmal erklärtes Ziel dieser Politik war, dessen soziale Relevanz abzubauen. In dieser traurigen Gestalt ist der Feminismus zu einer Staatsmacht geworden, die sich gebärdet wie eine Guerilla im Kampf gegen einen übermächtigen Klassenfeind.
»Das Label ›Gender‹ verschleift sich in einem politischen Etikettenschwindel.«
Das Konzept ‚Gender‘ ist in der öffentlichen Wahrnehmung auf diese Weise heillos mit feministischer Politik und bürokratischer Frauenförderung verquickt worden. Für eine Naturwissenschaftlerin ist diese Politisierung schwer verständlich. Aber alle Sozial- und Kulturwissenschaften haben es schwerer, sich von gesellschaftlich aufgedrängten Problemen und politisch verlangten ‚Lösungen‘ zu distanzieren. Ihnen stellen sich Herausforderungen der Professionalisierung, von denen Wissenschaften hinter Labormauern keine Vorstellung haben.
So war auch die Politisierung der Geschlechterfrage lange die wichtigste Triebkraft zur Institutionalisierung der feministischen Geschlechterforschung. Inzwischen ist sie das größte Hemmnis ihrer intellektuellen Entfaltung. Trotz aller Akademisierung ist sie immer noch politisch gerahmt: in der Positionierung als kritische Gegenwissenschaft, in der Vereinnahmung durch Ministerien und soziale Bewegungen, in der Handlungsorientierung des Wissens und in der Rekrutierung ihres Personals. Sie folgt noch immer der Logik einer sozialen Bewegung: Sie fasst das Forschungspersonal in Termini politischer Repräsentation auf und fraktioniert Frauen, Männer und Queers. Und sie lässt sich als Vehikel der Frauenförderung verzwecken, um auf diese verquere Weise einen Teil der Karrierehemmnisse für Frauen an Universitäten aus dem Weg zu räumen.
Die feministische Geschlechterforschung ist so zu einer gendered science geworden. Sie sieht genauso aus wie die Wissenschaft, die sie so vehement als androzentrisch kritisiert hat. Einen solch hohen Grad homosozialer Verdichtung und Schließung gibt es in keinem anderen Forschungsgebiet. Und die Geschlechterforschung steckt eben deshalb so tief in den Unterscheidungsroutinen der Gesellschaft, die sie kritisiert, weil sie sich durch ein besseres, kritisches Bewusstsein von diesen Routinen ausgenommen sieht. Es ist eine einzige Peinlichkeit, dass der Feminismus, der das Gendering von Wissensprozessen mit guten Gründen kritisierte, selbst nicht in der Lage war, Wissensprozesse unter Absehung von Geschlecht zu organisieren.
Dies hat intellektuelle Folgen: Leicht erkennbar ist eine politisch selektive Themenwahl der Forschung. Maximale Sensibilität gibt es – verständlicherweise – für Aufstiegshemmnisse von Frauen und persistente soziale Ungleichheiten; völlig unterforscht bleiben dagegen kulturelle Aspekte des Geschlechterverhältnisses (etwa politisch inkorrekte Attraktivitätsnormen oder lebensweltliche Biologismen) sowie die vorhandenen Benachteiligungen von Jungen und Männern. Sie wurden den – verständlichen – Ressentiments von Männerrechtlern überlassen.
Ein weiterer, viel schwerer zu überwindender Bias der Geschlechterforschung liegt in der systematischen Überschätzung der Relevanz, die die Geschlechterunterscheidung für moderne Gesellschaften hat. Wir leben nicht mehr in einer Genusgesellschaft, die alle Tätigkeiten und Positionen mit geschlechtlichem Sinn versieht, sondern in einer Gesellschaft, die zwar in bestimmten Feldern noch hartnäckig nach Geschlecht unterscheidet, es in vielen Feldern aber erfolgreich vermeidet. Es gibt eine längst realisierte Geschlechtsblindheit der modernen Gesellschaft, deren Bedeutung eine ‚Geschlechterforschung‘ auch deshalb unterschätzt, weil sie fast nur von Frauen betrieben wird. Denn wir strukturieren unsere Weltwahrnehmung nach unserer Selbstwahrnehmung. Die von Frauen wird aber kulturell ungleich stärker als die von Männern darauf verpflichtet, die Geschlechtszugehörigkeit überhaupt für einen hochrangigen Umstand ihres Lebens zu halten. Die Geschlechterforschung wird daher von Personal durchgeführt, auf das die Gesellschaft das Geschlecht projizierte. Vor allem dieser Bias bestimmt ihre Wissensproduktion. Und auch die Überzeugung, das Geschlecht sei eine weibliche Eigenschaft, ist ein wissensgeschichtliches Erbe des 19. Jahrhunderts. Die Frauenforschung hält in ihrer Sozialorganisation emphatisch an diesem Erbe fest: Das Geschlecht sind die Frauen. Es ist ihre Zuständigkeit und sie sind die kulturellen Stammhalter dieses Erbes.
Der Feminismus wird in der Geschlechterforschung von vielen immer noch als Name einer Art politischer Partei aufgefasst – eine geschlossene Wagenburg – anstatt als das viele (auch den Autor dieser Zeilen) prägende Generationenprojekt, das er war. Der Kern des feministischen Bekenntnisses liegt in einer großen, stillen Hoffnung: das Böse in der Welt in einem Geschlecht verorten zu können und insofern selbst ‚das andere‘ zu bleiben. Der Feminismus bleibt damit der Geschlechterunterscheidung so verpflichtet wie der Atheismus der Religion. Er kann sie nur gebrauchen, repräsentieren und wütend kritisieren, aber nicht beobachten wie die Gender Studies das tun, um einen Fall von Humankategorisierung zu verstehen. Dafür braucht es (1) ein anderes Rollenverständnis und (2) eine andere Organisation der Forschung.
Ein anderes Rollenverständnis
1. Die Forschung über Frauen, Männer und Queers muss ihren tradierten politischen Separatismus endlich überwinden und auf dem Weg einer professionellen Distanzierung ihre angestammten Loyalitäten gegenüber sozialen Bewegungen in den Griff kriegen. Gefragt sind nüchterne Bestandsaufnahmen ungleicher Chancen in der Konkurrenz der ‚Geschlechter‘, Explorationen der Vielfalt neuer, posttraditionaler Lebensstile, luzide Analysen der Paradoxien im Geschlechterverhältnis, und kaltblütige Bilanzierungen der historischen Gleichzeitigkeit des politisch Ungleichzeitigen – von archaischen Gewaltakten gegen Frauen über die Irrelevanz von Geschlecht bis zur Benachteiligung von Männern. Wer diesen Nerv nicht hat, sollte nicht über Geschlechter forschen. Wer ihn hat, könnte das Motto variieren, das Hans-Joachim Friedrichs einmal für die Rollendifferenzierung des Journalisten vom politisch denkenden Bürger prägte: „Eine gute Gender Forscherin erkennt man daran, dass sie sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache.”
»Eine gute Gender Forscherin erkennt man daran,
dass sie sich nicht gemein macht mit einer Sache.«
Eine ebenfalls quasi-journalistische Aufgabe liegt in einer anderen Darstellung der Geschlechterforschung in der Öffentlichkeit. Sie fällt auch hier eher durch politischen Lärm auf. Da treten Professorinnen, die sich in ihrem besseren politischen Bewusstsein eingebunkert haben, zum Vergnügen der Massenmedien in eine traurige Gesellschaft von revanchistischen Männern und Comedians, die ausrangierte Sexismen pflegen – ein unerquickliches Schlammcatchen ewig Gestriger gegen ewig Vorgestrige. Anstelle eines subkulturellen Jargons voller Kampfvokabeln, der auf exklusive Gruppenbildung zielt, braucht es eine Kommunikationsstrategie, die Verantwortung für den Denkstil des je eigenen Faches übernimmt und auf diese Weise öffentlich verstehbar den nostalgischen Biologismen unserer Gesellschaft entgegentritt. Eine ‚Gegenwissenschaft‘ kann das nicht, sondern nur ein Fach, das seine Zuständigkeit gegenüber der Gesellschaft wahrnimmt.
Eine andere Forschungsorganisation
2. Neben einem veränderten Rollenverständnis braucht es eine Öffnung des disziplinären Horizonts. Vor allem die Gender Studies (im engeren Sinne) stehen hier vor zwei Erweiterungen: a) eine Überführung der Lektionen und Gegenstände der Geschlechtsdifferenzierungsforschung in den Kanon ihrer jeweiligen Fächer, also etwa der Allgemeinen Geschichte, Allgemeinen Soziologie usw. Dieser Prozess hat längst begonnen (vor allem in der Geschichts- und Literaturwissenschaft) und macht dem thematischen Separatismus ein Ende. b) Eine Überführung der Gender Studies in eine erweiterte transdisziplinäre Differenzierungsforschung, die die Unterscheidung der Menschen nach Geschlecht nur mehr als einen interessanten Fall unter anderen untersucht. So braucht es auch einen Ausstieg aus den Gender Studies, um die Fragen der Kreuzung von Gender mit ähnlich politisierten Unterscheidungen – etwa Rasse, Ethnizität und Religion – nicht in eine fruchtlose ‚oppression olympics‘ münden zu lassen, sondern ohne gender bias zu analysieren.
Die Gender Studies sind jenes kulturwissenschaftliche Unternehmen, das den praktischen Vollzug der Geschlechterdifferenz in der Gesellschaft beobachtet: ihren historischen Auf- und Abbau, ihre hartnäckigen Rekonstruktionen, ihre Wandlungs- und Verfallsprozesse, paradoxen Wendungen und ihre widersprüchliche Selbstabwicklung. Vor unseren Augen werden alte soziale Kategorien dekomponiert: die ‚Homosexualität‘ löst sich in geschlechtsgleiche Intimbeziehungen auf, die ‚Mutter‘ wird durch die Reproduktionsmedizin in verschiedene Figuren aufgespalten, der ‚Mann‘ verliert sich in Rollen (wie Ernährer, Beschützer, Kämpfer usw.), die allesamt auch Frauen einnehmen können. Die Männer werden dabei weiter Macht abgeben müssen. Aber auch den Frauen wird das passieren: bei der Mutterschaft etwa, deren millimeterweise Abtretung auch ihnen Ersetzbarkeitskränkungen beschert; und bei der Moralität: Erfolgreiche Frauen werden die einst unbescholtene ‚Weiblichkeit‘ weiter desavouieren und die alte Hoffnung des Feminismus zersetzen. Und das ist gut so.
Postscriptum
P.S.: Ein Text wie dieser wird zwangsläufig hineingesogen in die Stimmungen und Strömungen, in denen er sich artikuliert: der eingeübten Indifferenz der meisten, bei einem immergleichen Thema auf taub zu stellen, dem verdrucksten Schweigen der politisch Gutwilligen, die schon lange ahnen, dass etwas schief läuft, dem revanchistischen Lauern von Maskulisten auf schlagkräftige Argumente und der misstrauischen Hermeneutik der Insassinnen der Wagenburg, die den Autor schon an seiner vermeintlichen Geschlechtszugehörigkeit als potenziellen Frauenfeind verbuchten. Ach Schwestern! Es gibt ein postnormatives Denken nach dem Feminismus: klar, heiter, kritisch, theoretisch innovativ und empirisch lernfähig. Sein einziger Nachteil: Es weiß nicht immer sofort, wer der Täter war.