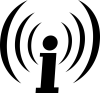Von Marina Kormbaki
Berlin. Polizei und Grenzschutz mögen Schlepper und Schleuser jagen, gegen den wichtigsten Fluchthelfer sind sie machtlos. Er ist unauffällig, bestens vernetzt und spricht so ziemlich jede Sprache. Er weiß, wo unüberwindliche Zäune stehen und wo nicht, wo Boote warten, wo Soldaten, und er passt in jede Hosentasche. Seine Kartensammlung und sein Kompass sind Navigator für Menschen, die von Syrien bis nach Deutschland wandern. Er weist Flüchtlingen den Weg in die Sicherheit.
Die These, wonach die gegenwärtigen Flüchtlingsströme ohne Smartphone und Internet bei Weitem kein so großes Ausmaß erreicht hätten, ist nicht verwegen. Alle Informationen, die überlebenswichtig sind für Flüchtlinge, lassen sich in kürzester Zeit abrufen. Europa erlebt gerade die erste digital koordinierte Einwanderungswelle seiner Geschichte.
Aber kann der Fluchthelfer auch zum Flüchtlingshelfer werden? Zum kundigen Begleiter in einem fremden Land? Anke Domscheit-Berg sieht die Chancen. Die Publizistin und Netzaktivistin will das Handy zum Integrationshelfer für all jene machen, die jetzt in Deutschland in ein neues Leben starten.
Anke Domscheit-Berg hat am Wochenende in Berlin den bundesweit ersten „Refugee Hackathon“ auf die Beine gestellt. Hackathons sind Events, bei denen Software-Programmierer – Hacker – innerhalb eines festen Rahmens – wie beim Marathon – neue Programme austüfteln. Domscheit-Berg hatte mit bestenfalls 50 Programmierern und Grafikdesignern gerechnet, die 48 Stunden lang Apps für die Bedürfnisse von Flüchtlingen entwickeln würden. Gekommen sind dann mehr als 300 Ehrenamtliche. Junge Leute, die zum Arbeiten nur ihren Laptop brauchen. Und natürlich erfahrene Berater.
Erst hören die Programmierer nämlich den Flüchtlingen zu. 40, 50 junge Männer und Frauen erzählen von dem, was sie in ihrem neuen deutschen Alltag plagt. Steve und Ben zum Beispiel, beide aus Kamerun, hätten gern etwas zu tun, sie hätten gern Arbeit. „Deswegen sind wir heute hier“, sagt Steve. „Wir möchten uns einbringen“, sagt Ben. Viele wünschen sich freies Internet in den Flüchtlingsunterkünften, andere würden gern mehr mit Einheimischen unternehmen. Und die meisten stehen vor hohen Sprachhürden, ganz besonders oft bei Behörden.
Die Computerleute übersetzen die Bedürfnisse der Flüchtlinge, aber auch der anwesenden Helfer in Programmiersprachen, codieren Apps und Websites. „EinstiegDeutsch“ ist eine Sprachlern-App, „Bescheid OCR“ erklärt Behördenpost, „WeConnect“ soll Begegnungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen koordinieren, der „VolunteerPlanner“ bringt Freiwillige in Flüchtlingsunterkünften zusammen. Außerdem geht eine Karten-App bald online, die mit flüchtlingsrelevanten Anlaufstellen gespickt werden kann, etwa mit Angaben über Sprachschulen, Ämter, Unterkünfte. Und auch der Vorschlag von Ben und Steve wird aufgegriffen: Eine Job-App soll bald fertig sein, mit Rechtsauskünften und Stellenangeboten.
Es ist nicht so, dass es in Deutschland bisher keine Online-Angebote für Flüchtlinge und Helfer gebe. Aber viele Entwickler wissen nichts voneinander, das Rad wird immerzu neu erfunden. Mit einem immer wiederkehrenden Mangel, meint Anke Domscheit-Berg: „Die Hilfsbereitschaft hat es schwer, dort anzukommen, wo sie tatsächlich gebraucht wird. Es gibt Online-Foren, die den Bedarf erfassen, und andere, die das Angebot dokumentieren – und dazwischen sitzen Menschen, die manuell beides zueinander bringen müssen. Diese Hürde wollen wir technisch umgehen, wir wollen Plattformen erschaffen, die Flüchtlinge und Helfer direkt zueinander führen, ohne Mittlerinstanz.“
Anke Domscheit-Berg hat mal als Unternehmensberaterin gearbeitet. Vielleicht liegt es daran, dass sie das Wort „Flüchtlingskrise“ nicht mag. „Das ist keine Krise, das ist eine Challenge“, sagt sie und ballt die Faust: „Challenge accepted.“ Herausforderung angenommen. Und nun? „Wir wünschen uns, dass die Behörden mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten – so wie damals, bei der Oderflut, als sich Staat und Bürger mit wilder Entschlossenheit ans Werk gemacht haben.“ Domscheit-Berg ist Brandenburgerin. „Zurzeit ist es doch so, dass vor allem die Zivilgesellschaft die Sandsäcke auffüllt und der Staat hofft, dass das Wasser weicht. Aber die Einwanderung ist kein Hochwasser, sie verschwindet nicht.“
Schaut man den Computernerds bei der Arbeit zu, wird man in der Tat den Eindruck nicht los, dass sie Leerstellen ausfüllen, die der Staat hinterlässt. Ein Projekt macht dies besonders deutlich: Lagesonum. Lageso – das ist die Abkürzung des Berliner Landesamts für Gesundheit und Soziales, inzwischen aber auch ein Synonym für komplettes Missmanagement. Syrer warten tage- und wochenlang vor der Meldestelle in Berlin-Moabit bis zum Aufruf ihrer Nummer, das System ist schwer durchschaubar, der Reihe nach geht es jedenfalls nicht. Über die App soll nun der Status der Wartenummern abrufbar sein. Ahmad und Mohamed, zwei Syrer Anfang zwanzig, wären sehr dankbar, wenn ihnen dadurch weitere lange Tage in der Kälte vor dem Amt erspart blieben.
Die beiden sind seit knapp vier Monaten in Berlin. „Selbstverständlich“, sagen sie, sei das Handy der wichtigste Begleiter bei ihrer Flucht aus Damaskus gewesen. Es waren ziemlich geläufige Programme, über die sie ihre Reise organisierten. Die Offline-Karten von Maps.me wiesen ihnen den Fußweg durch mazedonische Wälder, über Booking.com suchten sie günstige Schlafstätten in Ungarn, Schlepper waren gut via Whatsapp zu erreichen. Unverzichtbar waren für sie die Erfahrungsberichte anderer Geflüchteter bei Facebook. „Das galt jedenfalls vor vier Monaten, als wir uns auf den Weg machten“, sagt Ahmad. Inzwischen sei es einfacher. „Jetzt sind so viele Menschen unterwegs, da braucht man keine Karten. Man muss bloß ihren Fußspuren folgen.“
Heute zählen die Sprachprogramme zu den wichtigsten Werkzeugen auf ihren Smartphones. Ahmad schwört auf die Sprachlern-App Duolingo, sein Freund Mohamed lässt auf Memrise nichts kommen. Warum? Kaum hatten die beiden einen Platz im Sprachkurs ergattert, begannen die Herbstferien. Wochenlange Pause. Nur Apps machen keine Ferien.
Die jungen Syrer haben ebenfalls einen Vorschlag für eine App, die dringend entwickelt werden müsste. „Gelbe Seiten für Flüchtlinge, auch auf Arabisch“, sagt Ahmad. „Mit Nummern und Adressen von Unterkünften, Sprachschulen, Behörden, Anwälten.“ Bestimmt keine schlechte Idee.
Herr Hunger, ist die ständige Präsenz von Smartphones mit ein Grund für die große Zahl von Flüchtlingen in Europa?
Fluchtbewegungen hat es immer schon gegeben, auch große. Die Ursachen sind vor allem Kriege und Katastrophen. Aber mithilfe des Internets verlaufen Fluchtbewegungen strukturierter. Smartphones sind das wichtigste Utensil für Flüchtlinge: Sie bieten Orientierung, Informationen über das Aufnahmeland, ermöglichen den Kontakt zur Heimat. Wahrscheinlich trägt die schnelle, unmittelbare Informationsübertragung zur Beschleunigung von Migration bei.
Senkt die weltweite Digitalisierung also die Hemmschwelle zur Auswanderung?
Ja, davon gehe ich aus. Informationen in Internet und Fernsehen tragen bei zu mehr Transparenz: Überall auf der Welt können Menschen erfahren, wie die Lebensverhältnisse in anderen Erdteilen sind, wie gut sie beispielsweise hier bei uns sind. Zudem finden Informationen rasche Verbreitung und erzeugen dadurch Handlungsdruck: Rasend schnell hat sich zum Beispiel verbreitet, dass sich im Sommer für Flüchtlinge ein Fenster in Deutschland geöffnet hat – eine Gelegenheit, die viele Menschen schnell wahrnehmen wollten.
Welche Folgen hat eine solche digital befeuerte Auswanderung für Familien?
Via Internet haben Auswanderer die Möglichkeit, am Leben ihrer Verwandten in der Heimat teilzuhaben. Auch dadurch wird Migration indirekt befördert. Das Internet führt dazu, dass immer mehr Familien in unterschiedlichen Ländern leben und arbeiten. Zum Beispiel arbeiten in Deutschland sehr viele osteuropäische Frauen, deren Kinder im Herkunftsland aufwachsen, etwa bei den Großeltern. Und dennoch nehmen die Mütter am Alltag der Kinder teil, indem sie via Skype zusammen Hausaufgaben machen oder sich beim Zubettgehen per Videotelefonie zu ihren Kindern schalten. Das ist ein wachsender Trend.
Bergen Online-Angebote auch Gefahren?
Die Qualität der Angebote steht und fällt mit der Verlässlichkeit und Seriosität der darin enthaltenen Informationen. Falsche Informationen finden rasch Verbreitung, dahinter stehen nicht selten die Interessen Krimineller, etwa von Schlepperbanden. Umso wichtiger ist es, dass staatliche Stellen, aber auch Hilfsorganisationen gesicherte Informationen zur Verfügung stellen – nicht nur für Menschen auf der Flucht, sondern auch für jene, die bereits angekommen sind. Fehlinformationen und Halbwissen in den Bereichen Arbeit, Bildung und Gesundheit müssen unbedingt vermieden werden. Es ist im Interesse des Staates, mehr zu investieren in die Qualität seiner Informationsangebote.
Interview: Marina Kormbaki