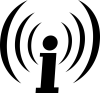// Ein Kommentar über BündnispartnerInnen der angestellten LehrerInnen //
"Am 11. März steht Berlin still." So informierte die Berliner Morgenpost die HauptstädterInnen. Gemeint ist damit der Warnstreik des öffentlichen Dienstes am kommenden Mittwoch. 60.000 Beschäftigte sind zum Streik aufgerufen, darunter die angestellten LehrerInnen und ErzieherInnen der Schulen. Für die LehrerInnen geht es nicht nur um die ritualisierte Tarifforderung nach 5,5 Prozent mehr Lohn. Im Jahr 2013 haben die angestellten LehrerInnen Berlins an 17 Tagen die Arbeit niederlegt, um eine Gleichstellung mit ihren verbeamteten KollegInnen zu erreichen. Eine tarifliche Entgeltordnung, damit der Senat ihre Löhne nicht mehr einseitig diktieren kann, haben sie bis heute nicht.
Bei keinem anderen Arbeitskampf hört man so oft, dass es nicht ums Gehalt gehe, sondern um eine uralte Forderung der Arbeiterbewegung: "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit." Viele schaffen die 50 oder mehr Arbeitsstunden pro Woche, weil sie ihren Job lieben. Aber es zehrt an den Kräften, dabei jeden Tag zu wissen, dass BeamtInnen für die gleiche Arbeit pro Monat 500 Euro mehr verdienen.
Ein Streik der LehrerInnen kann keinen wirtschaftlichen Druck erzeugen, weil sie nur indirekt in die Produktion eingebunden sind. Genau genommen spart ihr "Arbeitgeber" mit jedem Streiktag sogar Geld. Und der Berliner Senat verlässt sich darauf, dass die LehrerInnen trotz aller Ausstände ihre SchülerInnen irgendwie durch die Prüfungen bringen. "Wenn in einem Betrieb gestreikt wird, merkt das der Chef sofort", erklärt der Lehrer Torsten Hofstetter. "Aber bei uns merkt der Chef den Streik erst, wenn die Eltern sich beschweren." Ein LehrerInnenstreik muss deshalb weh tun. Und er ist ein politischer Streik – nur mit politischem Druck kann er gewonnen werden.
Sicher werden jetzt schon die offiziellen SchülerInnen- und ElternvertreterInnen in Stellung gebracht, die sich gegen Streiks "auf Kosten der SchülerInnen" aussprechen werden. Das sind die gleichen "VertreterInnen", die den seit Jahren herrschenden Personalmangel an Berlins Schulen hinnehmen. Die PädagogInnen haben jedoch potenzielle BündnispartnerInnen, die bislang viel zu wenig angesprochen werden: So hätten zum Beispiel verbeamtete LehrerInnen durchaus die Möglichkeit zu streiken. An mindestens einem Oberstufenzentrum gab es eine Art "Streikunterricht" vor dem Schultor, um die SchülerInnen über den Arbeitskampf diskutieren zu lassen. Das sollte Schule machen.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sollte SchülerInnen direkt mit zum Streik aufrufen. Schließlich leiden sie am meisten unter fehlenden LehrerInnen und ständigem Unterrichtsausfall. Viele teilen die Sicht der 16-jährigen Tabea, die sagt: "Ihre schlechten Arbeitsbedingungen sind unsere schlechten Lernbedingungen." Natürlich wollen sie nicht bevormundet werden – aber man sollte SchülerInnen die Chance geben, sich schon jetzt über ihre Rechte als zukünftige Lohnabhängige zu bilden.
Vor zwei Jahren kamen manchmal Hunderte SchülerInnen mit zum Streik, auch eine gemeinsame Streikversammlung fand statt. Mit einer viel breiteren Streikfront könnten die LehrerInnen richtigen Druck aufbauen. Denn sie haben eine geradezu heroische Ausdauer, aber wollen die aktuelle Streikrunde nicht wieder ohne Ergebnis beenden.
von Wladek Flakin, Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO)
Eine kürzere Version des Artikels erschien im Neuen Deutschland am 6.3.
Beim Warnstreik am Mittwoch sind SchülerInnen zur Solidarität aufgerufen.