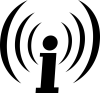Seit einem Jahr dürfen Bulgaren und Rumänen in Deutschland arbeiten - gibt es den befürchteten Sozialbetrug? Eine Bilanz
Von Jan Sternberg
Schwedt/Oldenburg. Das Heimweh, sagt Luisa Din, kommt nur, wenn sie nichts zu tun hat. Bevor sie zu viel an Sibiu denkt und an ihre Familie, stürzt sich die zierliche 28-Jährige wieder in die Arbeit. Die nächste 24-Stunden-Schicht auf der Kinderstation kommt bestimmt, die Weiterbildung frisst zusätzlich Zeit, da bleiben kaum ein paar Minuten zum Durchatmen im Plattenbau in Schwedt. Die junge Kinderärztin aus Siebenbürgen ist eine von 534000 Menschen aus Bulgarien und Rumänien, die in Deutschland leben. 2014 kamen bis November 120000 Menschen aus diesen beiden Ländern hinzu.
Luisa Din hat es nach Brandenburg verschlagen, an die polnische Grenze.
Die 35000-Einwohner-Stadt Schwedt, von Industrie geprägt, ist leer und
grau. Kein Vergleich mit ihrer Heimat, dem schmucken, quirligen Sibiu
(Hermannstadt). Dort hat Luisa Din Abitur gemacht und Medizin studiert.
Auch ihre Mutter ist Ärztin. Sie hat Luisa und ihre Brüder erst in den
deutschsprachigen Kindergarten, dann aufs deutsche Gymnasium geschickt -
damit diese das Rüstzeug hatten, auch im Ausland ihr Glück zu suchen.
Dass dieses Glück im maroden und korrupten rumänischen Gesundheitssystem
nicht zu finden ist, wusste Luisas Mutter aus eigener Erfahrung.
Der neue rumänische Präsident Klaus Johannis kündigt im Gespräch mit
dieser Zeitung an, das Gesundheitssystem des Landes von Grund auf
reformieren zu wollen. Dann könnten abgewanderte Mediziner wie Luisa Din
zurückkommen. "Von Ankündigungen kann ich nicht leben", sagt sie. "Die
Politiker haben das versprochen, als ich mit der Schule fertig war, sie
haben es versprochen, als ich mein Studium beendet habe. Jetzt
versprechen sie es wieder", seufzt sie. "Für mich ist es zu spät, meine
Zukunft ist in Schwedt. Zumindest kurzfristig." Und auf lange Sicht?
"Vielleicht auch."
2014 hatten Bulgaren und Rumänen erstmals vollen Zugang zum deutschen
Arbeitsmarkt. Wenn über sie geredet wurde, dann ging es selten um
Menschen wie Luisa Din, die sich mit einem Hochschulabschluss in der
Tasche auf den Weg Richtung Nordwesten machen. Es ging um Klischees und
Ängste - um die Einwanderung der Ärmsten, speziell der Roma, ins
deutsche Sozialsystem. Fünf Jahre lang, seit dem EU-Beitritt der beiden
Balkanländer 2007 und dann bis 2013, hatte Deutschland seinen
Arbeitsmarkt für Bürger der Neu-Mitgliedsländer abgeschottet. Eine
Hintertür aber blieb offen: Selbstständige durften sich niederlassen.
Die Folge war ein Boom von Einzel- und Kleinst-"Unternehmen", deren
"Geschäftsführer" sich zu Dumpinglöhnen verdingten, einige lebten auch
allein vom Kindergeld. Allein im Berliner Bezirk Neukölln gab es 3000
Gewerbeanmeldungen von Bulgaren und Rumänen.
CSU-Chef Horst Seehofer hatte vor genau einem Jahr ein neues Thema
gefunden: "Wer betrügt, fliegt", rief der Bayer damals Richtung Balkan,
um die Neuen zu begrüßen und Stimmung in Deutschland zu machen. In
Rumänien war nicht nur Klaus Johannis darüber erbost: "Das Problem
Rumäniens, dass unsere besten Köpfe gehen, ist weit größer als das
Problem der anderen Staaten, dass auch ein paar Zocker mitkommen", sagte
der damalige Bürgermeister von Sibiu. Gleichzeitig riefen mehr als 30
Kommunen um Hilfe: Städte wie Duisburg und Dortmund oder der Berliner
Bezirk Neukölln sahen sich mit den Folgekosten der sogenannten
"Armutsmigration" alleingelassen. Es bildete sich eine neue Unterschicht
in den Armenvierteln: Roma-Großfamilien, deren Kinder nie eine Schule
von innen gesehen hatten. Genau ein Jahr später ist es Zeit für eine
Bilanz: Wie sieht die Realität jenseits der Kampagnen aus?
Ziemlich gut, sagt Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Er spricht von einem
"Beschäftigungswunder". Im ersten Jahr des vollen Zugangs zum
Arbeitsmarkt stieg die Quote der Bulgaren und Rumänen in einem regulären
Arbeiter- oder Angestelltenverhältnis um jeweils 13 Prozent an. 46
Prozent der Bulgaren und 59 Prozent der Rumänen sind abhängig
beschäftigt, gerade bei den Rumänen ist diese Quote höher als bei
anderen EU-Ausländern.
Franziska Giffey, Bezirksstadträtin in Berlin-Neukölln, kann mit diesen
bundesweiten Zahlen nicht viel anfangen. "Die Lage in Neukölln hat sich
nicht geändert", sagt sie. "Bei uns landen nicht die Hochqualifizierten,
sondern Großfamilien, die mit vielen Kindern kommen, viele davon Roma.
Wir hatten gehofft, dass sie jetzt mehr Zugang haben zu geregelten
Arbeitsverhältnissen." Stattdessen steigen die Gewerbeanmeldungen weiter
an und die Hartz-IV-Zahlungen ebenfalls. 36 Prozent der Bulgaren in
Neukölln beziehen Sozialleistungen, bei den Rumänen sind es 44 Prozent.
"Das ist sehr viel", sagt Giffey, "aber das sind keine Betrüger, sondern
sie nehmen ihre Rechte wahr." 40 Prozent der erwerbstätigen
Leistungsbezieher seien Aufstocker, die zu Dumpinglöhnen auf dem Bau
arbeiten, in Hotels und Restaurants schuften, spülen, putzen. "Da gibt
es genügend Firmen, die so ihren Reibach machen", schimpft Giffey.
"Die Unternehmer wollen ihre Leute nicht fest anstellen, sie wollen
keine Verantwortung übernehmen, etwa für Krankenversicherung und
Unterkünfte", sagt auch Daniela Reim in Oldenburg. Reim, die selber aus
Rumänien stammt, berät Wanderarbeiter in der Fleischindustrie, ihre
Stelle ist vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium bezahlt. Auf
ihrem Handy erhält sie Hilferufe am laufenden Band. Von Arbeitern, die
schwer krank sind, aber sich nicht zum Arzt trauen, aus Angst, dass sie
dann sofort ihren Job los sind. Von Subunternehmern, die für ihre neuen
Arbeiter gleich die Gewerbeanmeldung mitorganisieren und diese dann
schuften lassen, elf bis zwölf Stunden pro Tag, sechs Tage die Woche,
für 1200 Euro im Monat und ohne Krankenversicherung. Dass in der
Fleischindustrie schon seit Dezember ein Mindestlohn von 8 Euro die
Stunde gilt, wissen einige Subunternehmer noch nicht einmal. Ihren
scheinselbständigen Arbeitern müssen sie ihn ohnehin nicht zahlen.
Schließlich gibt es genügend Menschen, die vom Job in Deutschland
träumen. "Wer sich beschwert, fliegt", sagt Daniela Reim. "In ein, zwei
Tagen ist Nachschub da. Dann fährt ein Bus nach Rumänien und kommt mit
neuen Leuten zurück."
Seit Oktober 2013 ist Reim die Ansprechpartnerin für die rumänischen
Arbeiter in Oldenburg, ihre Kollegin Mariya Krumova kümmert sich um die
Bulgaren. 15 Monate voller Hilferufe auf dem Handy, wie hält man das
aus? "Ich versuche, nicht zu viel an mich heranzulassen", sagt Reim. "Du
hörst Tag für Tag, wie deine Landsleute ausgeliefert und rechtlos
sind." Es kann sein, sagt Herbert Brücker vom IAB, dass die Folgekosten
des abgeschotteten Arbeitsmarkts für Deutschland höher sind, als es eine
volle Freizügigkeit von Anfang an gewesen wäre. So haben sich
ausbeuterische Systeme eingespielt, die zudem, über die
Hartz-IV-Aufstockerzahlungen, das Sozialsystem belasten.
Auf dem CSU-Parteitag Mitte Dezember hat Horst Seehofer ein positives
Fazit der "Wer betrügt, fliegt"-Kampagne gezogen. "Die CSU hat sich
durchgesetzt", bilanziert er, schließlich gibt es jetzt ein Gesetz zur
Verhinderung von Sozialbetrug. Ob es das Delikt überhaupt gibt, ist
allerdings strittig. Die Kriminalstatistik der Polizei weist für 2013
195 tatverdächtige Bulgaren und Rumänen in der Kategorie
Sozialleistungsbetrug aus. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Das sind
0,5 Promille der ansässigen Bevölkerung aus diesen Ländern.
Für Franziska Giffey ging diese Debatte ohnehin in die falsche Richtung.
Neukölln brauchte schlicht Geld, um die zusätzlichen Belastungen durch
die Armutsmigranten bezahlen zu können. Nach dreieinhalb Jahren
fortgesetzter Hilferufe haben sie nun Erfolg gehabt: 25 Millionen Euro
gibt es vom Bund, 465000 Euro davon fließen nach Neukölln. "Als wir
erfahren hatten, dass wir das Geld bekommen, konnten wir innerhalb von
zwei Wochen einen Plan mit konkreten Maßnahmen machen", sagt Giffey.
"Die können alle zum neuen Jahr anfangen. Wir haben Routine."
In Schwedt hat Luisa Din die Neujahrspause dazu genutzt, endlich einmal
wieder auszuschlafen. "Wie ein Baby", sagt sie. Nachwuchs gibt es
inzwischen wieder genug in der Stadt: 400 Geburten verzeichnet die
Station für 2014. Damit ist die Existenz der Kinderstation gesichert.
Vor zwei Jahren hatte sie ein halbes Jahr schließen müssen, aus
Ärztemangel. Dass es weiterging, liegt auch an Menschen wie Luisa Din.
Aus Griechenland, Bulgarien, Rumänien kommen die Kinderärzte, für die
Schwedt noch nach Hoffnung klingt. Und auch der neue Geburtenboom hat
etwas mit dem offenen Europa zu tun. 50 Kilometer entfernt liegt das
polnische Szczecin (Stettin) mit 400000 Einwohnern. Stettiner Schwangere
kommen gerne nach Schwedt, um hier ihre Kinder zur Welt zu bringen -
und zahlen privat.