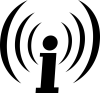Nationalismus
Ehre, Freiheit, Vaterland – diese Werte lassen sich unterschiedlich deuten. Der Wiener Politologe Weidinger meint dennoch: Burschenschaften sind nicht demokratietauglich.
Interview: Florian Gasser
ZEIT ONLINE: Herr Weidinger, Burschenschaften stehen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland stark in der Kritik. Warum eigentlich?
Weidinger: Der Kern des burschenschaftlichen Weltbildes besteht in der Einteilung der Menschheit in Völker und in einem emphatischen Bekenntnis zum eigenen, dem deutschen Volk, also letztlich im deutschen Nationalismus. Die in Österreich und auch in vielen deutschen Bünden vorherrschende Interpretation desselben ist eine dezidiert völkische, die Deutsch-Sein wesentlich über Abstammung bestimmt.
ZEIT ONLINE: Die Bundesrepublik in ihren Grenzen wird von Burschenschaften nicht akzeptiert?
Weidinger: Deutschland wird dabei als historischer Siedlungsraum von Deutschsprachigen verstanden. Daraus ergeben sich für nicht wenige Burschenschafter bis heute Gebietsansprüche in Norditalien, auf das Elsaß oder die sogenannten Ostgebiete. In der Neuen Deutschen Burschenschaft, die sich 1996 von der Deutschen Burschenschaft abspaltete, wird dagegen ein Vaterlandsbegriff gepflogen, der die politischen Grenzen der BRD explizit akzeptiert.
ZEIT ONLINE: Ein gemeinsamer deutscher Kulturraum lässt sich doch nicht wegdiskutieren.
Weidinger: Nein, und eine Begeisterung für deutsche Kultur geht nicht automatisch einher mit antidemokratischen Einstellungen und rassistischen Positionen. Im Fall der Burschenschaften ist diese Verquickung aber vielfach vorhanden. Eine andere Frage ist auch, ob der politische Deutschnationalismus durch Auschwitz nicht für alle Zeiten diskreditiert worden ist. Das wird in burschenschaftlichen Kreisen nicht so gesehen. Dort wird argumentiert, dass es zwar zu Verirrungen gekommen sei, aber der deutschnationale Gedanke durch die Ereignisse zwischen 1933 und 1945 nichts an Legitimität eingebüßt habe.
ZEIT ONLINE: Vor zwei Jahren wurde die Initiative Burschenschaftliche Zukunft (IBZ) gegründet, eine Abspaltung von Burschenschaften, die das biologistische Menschenbild nicht mehr mittragen wollten. Sie versucht nun das burschenschaftliche Wertefundament ins 21. Jahrhundert zu transferieren. Ist das möglich oder hat sich die Idee einfach überholt?
Weidinger: Das burschenschaftliche Wertegebäude besteht in der Trias Ehre, Freiheit, Vaterland. Das sind Begriffe, die man mit unterschiedlichen Bedeutungen füllen kann. Insofern ist durch diese Offenheit auch eine gewisse Aktualisierungsfähigkeit vorhanden. Ich persönlich finde aber, dass auch ein aktualisierter Vaterlandsbegriff im 21. Jahrhundert nicht mehr weit trägt.
ZEIT ONLINE: Warum denn nicht? Er könnte doch in Richtung einer europäischen Integration aufgeladen werden?
Weidinger: Es gibt in burschenschaftlichen Kreisen tatsächlich Debatten über eine eigene Europakonzeption. Ich habe allerdings den Eindruck gewonnen, dass es dabei vielfach um die alte Mission geht: die Erringung deutscher Hegemonie auf Umwegen.
ZEIT ONLINE: Gibt es burschenschaftliche Werte oder Ziele, die noch zeitgemäß sind und einen gesellschaftlichen Nutzen haben?
Weidinger: Die Selbstdarstellung von Burschenschaftern als Hüter von Freiheit und Demokratie teile ich nicht. Es gibt aber aktuelle Themen, die man vor dem Hintergrund ihrer Ideengeschichte bearbeiten könnte. Etwa die Frage von Überwachung und der Einschränkung persönlicher Freiheiten. Das würde aber voraussetzen, den Freiheitsgedanken stärker auf Individuen zu beziehen als auf völkische Einheiten.
ZEIT ONLINE: Heißt das, die Demokratie braucht keine Burschenschaften?
Weidinger: Nein, denn sie stehen selbst in einem Spannungsverhältnis zur Demokratie – nicht nur aufgrund des Primats des völkischen Nationalismus. Zu verweisen wäre etwa auch auf ein vorherrschendes Männlichkeitsideal, das kritische Selbstbeschau als Verrat und Kompromissfähigkeit als Schwäche verfemt, oder auf den burschenschaftlichen Elitarismus und die damit verbundene Geringachtung des demokratischen Souveräns. Der Elitarismus besteht in der Vorstellung, dass eine bestimmte – männliche – Elite zur Führung des Volkes berufen sei und allein das vermeintlich einheitliche Interesse dieses Volkes zu erkennen vermöge.
ZEIT ONLINE: Trotzdem versuchen sie in Demokratien politischen Einfluss zu gewinnen. In Österreich haben Burschenschaften eine politische Heimat, die FPÖ. In Deutschland gelang das nie. Könnte die AfD eine Burschenschafter-Partei werden?
Weidinger: Deutsche Bünde haben sich immer dort angeschlossen, wo es gerade am erfolgversprechendsten aussah: ab Ende der 1960er bei der NPD, dann bei den Republikanern. Bei Pro Köln hat man es auch versucht und jetzt eben bei der AfD. Aber keine Rechtsaußen-Partei in Deutschland hatte jemals den Erfolg der heutigen FPÖ. Man verlegte sich in der Bundesrepublik daher auf die Metaebene, suchte eine geistige Eremitage auf und betrieb kulturelle und ideologische Arbeit. In Österreich hatte man durch die FPÖ immer direkten Zugriff auf den politischen Prozess.
ZEIT ONLINE: Passen Burschenschaften zur AfD?
Weidinger: Wenn wir von der Deutschen Burschenschaft sprechen, davon, was nach all den Abspaltungen noch übrig ist, ist sie im Nahbereich der NPD nicht schlecht aufgehoben. Entsprechende Überschneidungen gibt es auch. Eine Initiative wie die IBZ hingegen würde sicher ganz gut zur AfD passen.
ZEIT ONLINE: Viele Bünde sind überaltert, geplagt von Nachwuchssorgen und manche müssen ihren Betrieb einstellen. Warum beschäftigt man sich überhaupt mit ihnen, wenn es sie vielleicht bald nicht mehr gibt?
Weidinger: Diese Erwartung würde ich nicht teilen. Es gibt akute Nachwuchssorgen, aber das ist ein chronischer Zustand. Man findet immer wieder Klagen über Personalnot und trotzdem haben Burschenschaften ihren Fortbestand stets gesichert, wenn auch auf niedrigem Niveau. Ihre Relevanz als Thema für Politik und Wissenschaft gründet in Österreich nicht in ihrer Größe oder gesellschaftlichen Durchdringung, sondern fast exklusiv in ihrer Verbindung mit der FPÖ. Gäbe es keine Partei, die Burschenschaftern ermöglicht, politisch wirksam zu werden, wären sie ein vernachlässigbares Phänomen.
ZEIT ONLINE: Ihr Buch über Burschenschaften heißt Im nationalen Abwehrkampf der Grenzlanddeutschen. Was bedeutet das?
Weidinger: Es ist das Zitat eines FPÖ-Politikers und Burschenschafters. Die Begriffe "nationaler Abwehrkampf" und "Grenzlanddeutsche" sind bezeichnend für die Selbstwahrnehmung der schlagenden Korporationen in Österreich. Sie sehen sich als Außenposten des Deutschtums, die ihre Identität ständig gegen Gefahren verteidigen mussten. Die Angst vor Überfremdung richtete sich zunächst vorrangig gegen slawische und jüdische Emanzipationsbestrebungen. Nach 1945 wurde es in Österreich zudem inopportun, sich als Deutscher zu bekennen. Burschenschafter erkennen seither ihre zentrale Mission darin, in der Alpenrepublik als letzte die deutsche Fahne hochzuhalten.
ZEIT ONLINE: In Österreich werden sie von einer wichtigen Partei akzeptiert, so wie sie sind. In Deutschland müssen sich die Burschenschaften ändern, da sie sonst in der Bedeutungslosigkeit verschwinden?
Weidinger: Das kann man als Bestandsaufnahme so sehen, ja. Die Frage ist aber, wie sich das Verhältnis mit der FPÖ weiterentwickelt. Man könnte durchaus die Position vertreten, dass die Burschenschaften der Partei letztlich mehr schaden als nutzen.
Bernhard Weidinger
Bernhard Weidinger lehrt an der Universität Wien und forscht zu den Themen Rechtsextremismus, neofaschistische Parteien und Bewegungen im internationalen Vergleich.
Bernhard Weidinger: "Im nationalen Abwehrkampf der Grenzlanddeutschen" Akademische Burschenschaften und Politik in Österreich nach 1945; Böhlau, Wien Köln Weimar 2015; 632 Seiten, 29,90 Euro