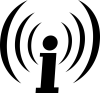In Hamburg gibt es Spannungen zwischen der linksautonomen Szene und der Stadtregierung. Die Sozialdemokraten von Bürgermeister Scholz haben bisher keine glückliche Hand gezeigt.
Ulrich Schmid, Hamburg
Nach den Ausschreitungen in der Freien und Hansestadt Hamburg am 21. Dezember, in die 5000 Menschen verwickelt waren und bei denen Dutzende von Menschen teilweise erheblich verletzt wurden, erschien in einem linken Internetportal unter dem Titel «Irgendwann werden wir schiessen müssen» der Text eines «unverbesserlichen Kollektivs», in dem es unter anderem hiess: «Unsere Hypothese für die Flora-Räumung: 200 Leute, 400 Mollis und dazu 50 GenossInnen mit Zwillen, jeweils 15 Schuss Stahlkugeln – und die Bullen werden den Abstand einhalten, der geboten ist. Zweitausend bewaffnete, mit Hand- und Schnellfeuerwaffen – und die Bullen werden das Viertel verlassen . . . Wir haben Dampf. Nicht nur wegen der Flora. Auch wegen ihr, aber nicht alleine wegen ihr. Nicht nur wegen der dreckigen Flüchtlingspolitik Europas. Auch wegen ihr, aber nicht alleine wegen ihr. Wir haben Dampf, weil uns das Empire das Wasser zum Leben abgräbt.»
Und dann: «Das Traurige zum Schluss. Irgendwann werden wir schiessen müssen. Das ist unvermeidlich. Nicht weil wir das Blutbad wollen. Sondern weil die Bullen uns jeden Raum genommen haben, den wir uns dann mit aller Gewalt zurückerobern müssen. Um atmen zu können. Um nicht in der Diktatur zu ersticken. Wir hoffen nur, dass wir nach der Scheisse, die uns der Bürgerkrieg abverlangt, noch genügend Menschlichkeit besitzen, das Andere, wozu wir antraten, zu verwirklichen.»
Stahlkugeln, Blutbad, Bürgerkrieg, Krieg auch mit der Orthographie: Schon arg, was da abgeht in Hamburg. Das Vokabular, das in der Hansestadt derzeit zum Einsatz kommt, ist nicht nur in dem larmoyanten Pamphlet der Unverbesserlichen ganz schön martialisch. Dabei haben die Ereignisse mit Bürgerkrieg natürlich nicht das Geringste zu tun, sondern sind die in Grossstädten normale Auseinandersetzung zwischen einer linksautonomen Szene, in der es viele Gewaltbereite gibt, und einem Bürgertum, zu dem alle grösseren Parteien zählen, auch die Grünen, auch die Linken, auch die Piraten. Doch an der Alster mag man es eben dramatisch.
Die gewaltbereiten Autonomen jedenfalls sind nicht geflohen. Sie sind gekommen am 21. Dezember, sogar mit Bussen, selbst aus München und Berlin, wenn man sich auf Martin Schäfer, den Vizefraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten in Hamburg, verlässt. Schäfer ist apodiktisch. Die Gewalt sei eindeutig von den Militanten ausgegangen, sagt er. Die Linksextremen hätten ihre Steine selber mitgebracht, «denn an Ort und Stelle fehlten keine». Fehler bei den Polizeikräften sieht er keine.
In der Roten Flora sieht man das einerseits ganz anders und dann doch wieder verblüffend ähnlich. Es ist nicht gerade überwältigende Willkommenskultur, die im «Selbstverwalteten Sozialen Stadtteilzentrum» im Schanzenviertel regiert. Zweimal heisst es sachlich «Verpiss dich, Arsch», bevor sich im Park hinter dem Zentrum Mischa und Kai, beide Anfang zwanzig und aus Hamburg, herablassen, die Lage zu erörtern. Nein, sagen sie, die Bullen hätten mit der Gewalt begonnen. Das wiederum sei natürlich mit Widerstand beantwortet worden, und tatsächlich sei Militanz auch völlig okay. Kai reckt sich etwas. Also wenn ihm ein Bulle frech komme – dann könne er für gar nichts garantieren, sagt er schleppend und plötzlich ein bisschen heiser, ganz wie Clint Eastwood. Und was genau bedeutet das? Barrikaden? Steine werfen? Kai blinzelt missmutig unter seiner Kapuze hervor. Nee, das zu erläutern hat er jetzt keinen Bock. Aus Mischas Kopfhörer zirpt Rap.
«Hamburg», das ist keine politische, sondern eine Gewaltfrage. Die Themen, um die es in der Hauptsache geht – die Rote Flora, das Schicksal von rund 300 afrikanischen Flüchtlingen und der erwogene Abriss der sogenannten Esso-Häuser in St. Pauli, die die Szene ebenfalls für sich reklamiert –, werden seit Jahren politisch auf breitester Ebene verhandelt, und dabei hat man nicht das Gefühl, das Empire ersticke die Alternativen. Die Rote Flora ist seit einem Vierteljahrhundert, seit November 1989, besetzt. Geräumt wurde sie nie. Die Flora ist seit Anbeginn der Auseinandersetzungen als kulturelles Stadtteil-Projekt definiert, und daran hat sich auch nichts geändert, als sie 2001 für 370 000 Mark an den Immobilienkaufmann Kretschmer verkauft wurde. Dennoch beunruhigte Kretschmer die Besetzer immer wieder mit Ideen für eine anderweitige Verwendung. Im Spätherbst kam es zu Spannungen im Zusammenhang mit dem Auftritt einer Hip-Hop-Gruppe, den Kretschmer per Hausverbot verunmöglichen wollte. Im Dezember drohte der Besitzer dann, die Flora bis Weihnachten räumen zu lassen. Die Besetzer waren empört, es kam zu den Ausschreitungen.
Wie einst in Zürich
Militanz ist die quasi offizielle Losung der Besetzer. Quasi, weil in der Roten Flora in einem Plenum abgestimmt wird, an dem sich jeder Anwesende beteiligen kann, ähnlich wie in den achtziger Jahren in der «Vollversammlung» des Autonomen Jugendzentrums in Zürich. Genau festzustellen, wer für welche Art von Militanz eintritt, ist unmöglich. Dass man irgendwann einmal werde schiessen müssen, glauben allerdings bei weitem nicht alle. Sicher ist nur, dass das Rote-Flora-Plenum «Militanz als Mittel autonomer Politik» definiert hat. Die Stadt ist misstrauisch geblieben, und in der aufgeladenen Stimmung hat sie sich Anfang Januar dazu hinreissen lassen, in Teilen von Altona, St. Pauli und des Schanzenviertels ein grosses «Gefahrengebiet» einzurichten, in dem die Polizei jeden Bürger ohne Gründe überprüfen durfte. Die Massnahme ist umstritten geblieben und bundesweit kritisiert und verlacht worden. Anwohner und Gewerbetreibende protestierten, die amerikanische Botschaft legte ihren Bürgern ans Herz, in der Zone vorsichtig zu sein und Menschenansammlungen zu meiden.
Inzwischen ist die Gefahrenzone wieder aufgehoben worden – offiziell, weil sie ihren Zweck erfüllte, in Wahrheit wohl, weil die Entscheidungsträger begriffen, dass ihnen der Gefechtsnebel etwas die Sicht getrübt hatte. Bürgermeister Scholz und sein energischer Innensenator Neumann aber verteidigen die Massnahme hartnäckig. Schäfer, der SPD-Vizefraktionsvorsitzende, weist darauf hin, dass die Reeperbahn seit 2005 als derartige Zone eingestuft ist, worüber sich kaum jemand erregt hat. Pikant ist bei alledem, dass das Gesetz, das die Polizei ermächtigt, aus der Zeit stammt, in der Christlichdemokraten regierten. Das macht es der CDU und anderen Bürgerlichen schwer, den Sozialdemokraten mangelnde Härte gegen linke Krawallmacher vorzuwerfen.
Doch sind die Bürgerlichen denn unisono gegen die Rote Flora? Nicht die Spur. Keine Partei in Hamburg will die Räumung, nicht einmal die CDU. Kretschmer liegt ein Angebot der Stadt vor, die Flora für 1,1 Millionen Euro zurückzukaufen, und seit dem 14. Januar bedürfen der Rückbau, Nutzungsänderungen oder die Errichtung neuer Bauten auf dem Areal sogar der Genehmigung des Bezirksamtes Altona. Damit dürfte der Status quo erst einmal zementiert sein. Wenn eine Stadt in Deutschland sich als weltoffen und tolerant versteht, dann ist es Hamburg. «Lass die nur machen», heisse das Motto dieser aufgeklärten Schicht, sagt uns Ulrich Karpen, Rechtswissenschafter und ehemaliger CDU-Politiker, und deshalb habe in den letzten 25 Jahren niemand auch nur ansatzweise Lust gezeigt, diesen so eklatanten Konflikt zwischen Rechtsstaatlichkeit und Politik anzupacken. Sicher, die Rote Flora sei ein «Geschwür im Rechtsstaat», sagt Karpen. Aber gleichzeitig warnt er dringend davor einzugreifen. Das gäbe einen riesigen Krach.
Radical Chic
Das eigentlich Interessante am Hamburger Konflikt ist denn auch nicht der Bürgerkrieg, sondern seine Soziologie. Nicht einmal 50 Meter weg von der bunt bemalten Flora befindet sich die erste Sushi-Bar. Es folgen in rascher Kadenz die guten Restaurants, die Galerien und die prachtvoll sanierten Jugendstilwohnhäuser, die untrüglichen Indizien also just jener Gentrifizierung, die in so vielen deutschen Grossstädten um sich greift und die die Radikalen in der Flora so leidenschaftlich verdammen. Und wer sind die gutverdienenden, adretten, kunstinteressierten Leute, die hier billigen Wohnraum für Bedürftige vernichten? Es sind beflissene und aufgeklärte Menschen, die sich zu allem Elend auch noch fast durchwegs als links definieren und an den Demonstrationen ihre helle Freude haben. Von arrivierten Grünen wimmelt es im Schanzenviertel förmlich, und wie etwa Antje Möller, die für die Grünen in der Bürgerschaft sitzt, identifizieren sie sich im Gespräch weitgehend mit den politischen Zielen der Flora-Besetzer.
Möller geht es nicht darum, Gewalt gegen den Staat zu legitimieren, sondern die Hintergründe des Konflikts zu erhellen, und das tut sie mit Bravour. Sie, die an der Demonstration am 21. Dezember ganz vorne dabei war, hat «grobe Ungeschicklichkeit» und Fehler der Polizei gesehen, Fehler, die dafür gesorgt hätten, dass die Situation «nicht mehr steuerbar» gewesen sei. Möller kritisiert die Gefahrengebiete, die zu Verschwörungstheorien förmlich einlüden. Die Grünen wollen versuchen, sie grundsätzlich zu verbieten, so, wie sie es bereits in der Regierung mit der CDU versucht hatten, allerdings ohne Erfolg. Von den Steinewerfern grenzt sich Möller klar ab. Sie will «grosse, kraftvolle, friedliche Demos». Genau das aber verhinderten die Radikalen. Den Bewohnern des Viertels hingegen fällt die Distanzierung von den Gewalttätern schwer, wie Gespräche nahelegen. Wieder fallen einem die Zürcher Unruhen ein, die unglaubliche Mühe, die es dem friedlichen Gros der Demonstranten damals bereitete, sich vom schwarzen Block abzusetzen, die kindliche Freude der Begüterten an etwas Radical Chic.
Die Kühle der SPD
Den regierenden Sozialdemokraten kann man derartige Neigungen gewiss nicht zur Last legen. Sie scheinen es im Gegenteil förmlich darauf angelegt zu haben, die Problemgruppen durch zackiges Auftreten und einen demonstrativen Mangel an Empathie zu vergraulen. Scholz hat in der Zeit, als die afrikanischen Flüchtlinge in Hamburg ankamen, durchaus zynisch gesagt: «Italien ist ein schönes Land.» Er nahm damit Bezug auf die Dublin-II-Regelung, die im Wesentlichen besagt, dass für die Durchführung eines allfälligen Asylverfahrens das Land verantwortlich sein soll, das die Einreise veranlasst oder nicht verhindert hat. Und Schäfer, der Vizefraktionschef, stellt im Gespräch nonchalant fest, ein Grossteil der «Lampedusa-Flüchtlinge» sei derzeit ja ohnehin nicht mehr in Hamburg. Vielleicht seien sie nach Italien gegangen, um sich entsprechend den Dublin-II-Regeln zu registrieren. Oder aber es habe ihnen hier ganz einfach nicht gefallen.
An solcher Sprache kann man Anstoss nehmen. Wenn es um die Militanten geht, ist die Klarheit der Sozialdemokraten allerdings sehr wohltuend. Schon am Tag nach den Demos forderte Neumann hartes Durchgreifen. Es sei nun an der Justiz, deutlich zu machen, dass es keine Akzeptanz für Gewalttäter gebe. Gewalt sei durch nichts zu rechtfertigen, er hoffe auf harte Urteile. Damit kann jeder Freund des Rechtsstaats leben. Dennoch wünscht sich so mancher Beobachter von den Genossen etwas mehr Flexibilität. Antje Möller konstatiert bei der Landesregierung eine «seltsame Kühle», die es den Grünen schwermache, sich mit den Sozialdemokraten zu verständigen. Wie Karpen und andere Beobachter führt sie das Verhalten der SPD teilweise auf die unguten Erfahrungen zurück, die man in der Zeit von Bürgermeister Ortwin Runde machte. Damals fuhren der SPD-Innensenator Wrocklage und kurzzeitig noch Scholz selber einen relativ milden Kurs, und die Partei musste zusehen, wie 2001 die CDU die Wahl gewann und der Rechtspopulist Ronald Schill Zweiter Bürgermeister und Innensenator unter Ole von Beust wurde.
Scholz scheint entschlossen, alte Fehler zu vermeiden. Gesprächsbereit ist seine Regierung natürlich dennoch, Neumann hat den Besetzern den direkten Dialog angeboten. In der Roten Flora zeigt man sich desinteressiert. Man sehe keinen Sinn darin, mit dem Senat über die Zukunft des Projekts zu verhandeln, sagte ein Sprecher. So etwas wie Verträge brauche man nicht. Angenehm wäre den Besetzern eine Enteignung Kretschmers, sicher. Doch letztlich sei es ihnen egal, wessen Gebäude sie besetzt hielten.