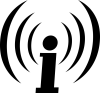Antisemitismus ist auch in Frankfurt Alltag. Über Übergriffe wollen Betroffene oft nicht reden.
Das Schlimmste war das Schweigen. Selten hat sich Elishewa Patterson-Baysal so alleine gefühlt wie an jenem Freitag Ende Februar in einem Frankfurter Supermarkt. Ein normaler Wochenendeinkauf. Patterson-Baysal wartet an der Kasse. Zwei junge Männer stellen sich hinter ihr an. Patterson-Baysal telefoniert mit ihrem Handy. Als das Gespräch beendet ist, wünscht sie ihrer Freundin am anderen Ende der Leitung einen frohen Feiertag: „Schabat Schalom!“ Elishewa Patterson-Baysal ist Jüdin. Und in diesem Moment wissen es auch die anderen Einkäufer.
Was danach folgt, kennt Patterson-Baysal schon. „In dem Moment, in dem du als Jüdin erkennbar bist, bist du natürlich verantwortlich für die Politik Israels.“ Die beiden Männer hinter ihr, beide augenscheinlich mit Migrationshintergrund, wollen umgehend von ihr wissen, ob sie sich nicht schäme für das, was „die Juden“ den Palästinensern antäten. Kindermörder seien sie allesamt. Als Patterson-Baysal das nicht auf sich sitzen lässt, werden aus den Beschimpfungen Drohgebärden. „Ich war ganz allein. Keiner der Umstehenden hat etwas gesagt“, erinnert sie sich. Patterson-Baysal lässt ihre Einkäufe stehen und geht.
Dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland einer wachsenden Bedrohung ausgesetzt sehen, war eine der Kernerkenntnisse aus dem Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus des Deutschen Bundestages, der Ende April vorgestellt wurde. Zwei Jahre lang hatte das Gremium antisemitische Vorfälle und Diskurse untersucht und vor allem großen Wert auf die Wahrnehmung der Betroffenen gelegt. Der Bericht konstatiert „eine deutliche Wahrnehmungsdiskrepanz“. Während sich die jüdische Gemeinschaft in Deutschland zunehmend bedroht fühle, empfinde die Mehrheitsgesellschaft Antisemitismus nicht als relevantes Problem.
Elishewa Patterson-Baysal bestätigt diese „Wahrnehmungsdiskrepanz“, „Wenn ich das Thema mit nicht-jüdischen Bekannten bespreche, heißt es schnell, dass das im Alltag doch keine Rolle spielt“ Ihre Erfahrungen sind ganz anders.
Wohnhauses mit Hakenkreuzen besprüht
Im Sommer 2014 wurde die Front ihres Wohnhauses mit Hakenkreuzen und dem Spruch „Juden raus“ besprüht, erzählt sie. Kurze Zeit später flog eine Flasche durch ihr Badezimmerfenster, begleitet von dem Ruf „Judenschwein“. Dass die Situation im Supermarkt vor wenigen Wochen glimpflich ausging, ist wohl in erster Linie der Tatsache zu verdanken, dass Patterson-Baysal sich zurückzog. Nicht immer ist das den Opfern antisemitischer Übergriffe möglich.
Wer in Frankfurt etwas über antisemitische Gewalttaten erfahren will, bekommt sehr viele allgemein gehaltene Aussagen zu hören. Ja, natürlich gebe es die, heißt es da in der Jüdischen Gemeinde. Das Problem sei bekannt, sagen städtische Behörden. Über konkrete Vorfälle aber, so scheint es, möchte kaum jemand öffentlich reden.
Frau T. ist eine Ausnahme. Sie will berichten, dabei aber anonym bleiben – auch wenn der Vorfall, den sie beschreibt, drei Jahre zurückliegt. Es begann mit einem Spiel. „Jude, Jude“, riefen sich vorwiegend muslimische Schüler auf dem Hof des Frankfurter Gymnasiums zu, das die drei Kinder ihrer Schwester besuchten. Der Jude, so die Regel, war das Opfer, das es zu fangen gilt. Überhaupt wurde „Jude“ ständig als Beleidigung benutzt
Als sich die Eltern der jüdischen Schüler beschwerten, griff die Schule ein und thematisierte die Vorfälle. Doch damit begannen die Probleme erst. Einige Tage später wurde eines der Kinder, ein 16-Jähriger, von einer Gruppe Mitschüler umringt und zusammengschlagen. Der Überfall ereignet sich in einer nahen U-Bahn-Station – damit die Lehrer es nicht mitbekommen. „Deshalb schweigen die Betroffenen“, sagt Frau T. „aus Angst, es noch schlimmer zu machen.“
Wie oft es zu solchen antisemitischen Gewalttaten in Frankfurt kommt, lässt sich nur schätzen. „Seit wir 1997 gestartet sind, ist die Zahl jedoch relativ konstant. Wir sprechen von sechs bis neun Fällen pro Jahr“, sagt Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, bei der seit 2016 auch die Beratungsstelle Response für Opfer rassistischer und antisemitischer Diskriminierung angesiedelt ist. „Es gibt aber eine sehr große Dunkelziffer“ , gibt Mendel zu bedenken,
Würde man allein die Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA) zur politisch motivierten Kriminalität als Grundlage nehmen, könnte man leicht zu dem Schluss kommen, dass in Hessen antisemitisch motivierte Gewalt bestenfalls ein kleines Problem ist. Für das Jahr 2016 – dies ergibt sich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Petra Pau –registrierten die Polizeibehörden in Hessen 21 antisemitische Straftaten, darunter eine Gewalttat.
Die Zahlen des BKA aber sind nicht sonderlich aussagekräftig. Nicht nur wegen der Dunkelziffer, sondern auch weil anti-israelische Straftaten gesondert erfasst werden. Deren Zahl liegt deutlich höher: 2014 etwa bei bundesweit mehr als 500. Damals eskalierte einmal mehr der Nahost-Konflikt, und die in Deutschland lebenden Juden wurden wieder einmal zu Sündenböcken für tatsächliche oder vermeintliche Verfehlungen Israels.
„Leider schaffen es einige Muslime nicht, eine Differenzierung hinzubekommen zwischen dem Handeln eines Staates, der sich selbst als jüdischer definiert, und einer der ältesten Religionen der Welt“, sagt Ünal Kaymakci, Vertreter der Islamischen Religionsgemeinschaft Hessen (IRH) im Frankfurter Rat der Religionen. Das Thema sei speziell bei muslimischen Jugendlichen hoch emotional behaftet. Und eine Diskussion darüber schwierig.
Kaymakci weiß, wovon er spricht. Nachdem er sich mehrfach äußerst kritisch über Israel geäußert hatte, ließ die jüdische Gemeinde ab Mitte 2015 aus Protest ihre Mitarbeit im Rat der Religionen ruhen. Man spricht trotzdem weiter miteinander, in der Hoffnung, eine Lösung zu finden.
Auf der Straße und in den Schulen hingegen wird oft nicht geredet, sondern beleidigt und geschlagen. „Neben der Verunsicherung durch den Rechtspopulismus wird auch der Antisemitismus unter Muslimen als Problem wahrgenommen“, stellt der Expertenkreis Antisemitismus in seinem Bericht fest.
Eine Einschätzung, die Kaymakci teilweise zumindest nachvollziehen kann. Dennoch bleibe Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem: „Da macht es sich die Mehrheitsgesellschaft zu leicht, wenn sie den Schwarzen Peter Antisemitismus, den sie gerne loswerden will, an eine neue Gruppe Missetäter weitergibt.“
Elishewa Patterson-Baysal muss man das nicht erklären. Sie kennt den Antisemitismus der Mitte genau, der sich in Vorurteilen über den vermeintlich weitreichenden Einfluss von Juden äußert. Sie bemerkt ihn in alltäglichen Gesprächen in Akademikerkreisen. „Dieser unterschwellige deutsche Antisemitismus ist ja nicht weg“, sagt sie. Aber in den letzten Jahren ist etwas Neues hinzugekommen.
Patterson-Baysal und ihre Familie haben bereits eine erste Konsequenz gezogen. Sie sind vom Erdgeschoss in den vierten Stock gezogen. Es gehe ihr schlecht damit, dass sie ihre ursprüngliche Wohnung aufgegeben habe. Aber die Sicherheit der Kinder geht vor. Ob sie ab und zu über die Alija, die Auswanderung nach Israel, nachdenke? „Natürlich“, platzt es aus ihr heraus. Noch aber ist es nicht so weit.