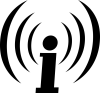Rechtsextremismusforscher David Begrich über Diskussionen mit der AfD
Am Mittwoch fand die Diskussion »Debatte statt Gewalt« im Volkshaus statt. Das Werk 2 wollte vorher nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung stehen, unter anderem weil auch Uwe Wurlitzer an der Veranstaltung teilnahm. Auch Linken-Politkerin Juliane Nagel sagte ihre Teilnahme deswegen ab, weil der AfD-Landtagsabgeordnete sie mehrfach »unter der Gürtellinie denunziert und angegriffen« habe. Sind solche Absagen sinnvoll? Im Interview erklärt Rechtsextremismusforscher David Begrich, warum selbst große deutsche Talkshows nicht richtig mit der AfD umgehen.
kreuzer: Wie sinnvoll sind Diskussionsveranstaltungen mit Vertretern rechtsautoritäter Bewegungen oder Parteien überhaupt? Kann eine solche Veranstaltung produktive, positive Ergebnisse für eine demokratische Gesellschaft bringen?
DAVID BEGRICH: Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Es ist dann sinnvoll, wenn man eine Auseinandersetzung so führt, dass sie die rechtsautoritären Ansätze aufdeckt, transparent macht und Alternativen dazu aufzeigt. Nicht sinnvoll ist dagegen, wenn man sich mit den Ideologieproduzenten dieses Milieus hinsetzt. Die haben auch kein Interesse am Austausch von Argumenten, sondern eine Mission: Sie wollen ihre Ideologie weitergeben.
kreuzer: Ist eine Debatte mit führenden AfD-Politikern dann nicht sogar schädlich?
BEGRICH: Das kommt darauf an. Derzeit gibt es praktisch kein Forum mehr, dass diesen Leuten verwehrt bleibt. Pegida, AfD und die Neue Rechte absorbieren einen Großteil der Aufmerksamkeit der Medien. Da gibt es eine Unwucht in der Debatte. So werden ausreichend Erzählungen von der Entsolidarisierung der Gesellschaft geliefert. Die Frage ist also, wo Erzählungen von Zusammenhalt und Solidarität Platz haben. Da müssen Diskurse sichtbar gemacht werden. Solche Veranstaltungen sind dann sinnvoll, wenn man rechtsautoritäre Inhalte dekonstruieren kann. Wenn diese nur wiedergegeben werden, ist so ein Format bestenfalls sinnlos.
kreuzer: Dann wäre die Konsequenz, AfD und Co. keine Bühne mehr zu geben.
BEGRICH: Ja, aber man muss aufpassen, dass man den Leuten in deren Umfeld nicht mit moralischer Überheblichkeit begegnet. Da gibt es viele Leute, die so ein Bedürfnis nach Distinktion haben. Die gehen nach einer Debatte nach Hause und sehen sich darin bestätigt, dass die anderen eben schlechte Menschen sind. Ich würde stattdessen vorschlagen, vor einem Diskurs klare Grenzen zu setzen. Wenn dann der Punkt erreicht ist, wo etwa klare Menschenfeindlichkeit vorgetragen wird, bricht man ab. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass man diese Grenzen immer wieder neu festlegen muss, dass es da keine bequemen Grundregeln gibt, auf denen man sich ausruhen kann.
kreuzer: Was bedeutet das für die Frage, ob man an einer Diskussionsveranstaltung teilnimmt oder nicht?
BEGRICH: Man muss sich immer eine Veranstaltung genau angucken und schauen, was ist die Zielgruppe, was ist der Zweck?
kreuzer: Wie sieht das bei einem Titel »Debatte statt Gewalt« aus?
BEGRICH: Der funktioniert nach meiner Erfahrung nicht. Die Frage ist doch, was soll debattiert werden? Wessen Gewalt? Wessen Gewalterfahrung? Zu sagen, Gewalt ist abzulehnen, reicht nicht, um zu verstehen, wie sie entsteht und an wen sie adressiert ist. Immer wenn man den Begriff Gewalt fallen lässt, ist der Boden weg. Der ist ideologisch so aufgeladen, da stimmen die Ebenen nicht. Außerdem ist »Debatte statt Gewalt« keine präzise inhaltliche Aussage. Debatten sind ja kein Wert an und für sich, es geht immer um die Inhalte.
kreuzer: Wie bewerten Sie die Ergebnisse vergangener Dialogveranstaltungen mit Rechtspopulisten, etwa in Dresden oder Magdeburg?
BEGRICH: Da gibt es keinen Kanon, ob eine Veranstaltung gut oder schlecht gelaufen ist, nur Indikatoren. Einer davon ist die Moderation. Die muss die hohe Kunst beherrschen, einerseits Inhalten Raum zu geben, die einem vielleicht quer liegen. Andererseits muss sie aber auch intervenieren, wenn diese Raumnahme ausschließlich wird. Die Moderation muss auch hinter die Fassade von Argumenten gucken. Die Neue Rechte spricht etwa gern vom »gesunden Menschenverstand«. Das ist eine Strategie. So verfolgen die Redner einen dezidiert politischen Zugriff mit antipolitischen Argumenten. Vertreter der AfD betreiben diese Form der ideologisierten Antipolitik ständig. Eine Moderation muss in der Lage sein, hinter diese Argumente zu gucken. Den großen Talkshows in Deutschland gelingt das derzeit gar nicht, zumindest nicht, wenn Frauke Petry zu Gast ist.
kreuzer: Warum?
BEGRICH: Die Moderatoren scheitern meist daran, etwa Frauke Petry auf eine Aussage festzunageln. Sie begreifen Petrys Strategie nicht. Die besteht immer darin, dass die AfD zwei Schritte vor und einen zurückmacht. Am Montag verschickt Petry eine Pressemeldung und fordert die Enttabuisierung des Völkischen. Dann wartet sie ein bis zwei Tage die Reaktionen ab und schickt dann eine neue Meldung hinterher, so habe sie das nie gemeint. Am Ende ist sie dann zwar einen kleinen Schritt zurückgegangen, hat aber den Raum des Sagbaren erweitert. So etwas muss man dekonstruieren, aufdecken. Einfach ist das nicht, aber möglich.
kreuzer: Gibt es dafür gelungene Beispiele?
BEGRICH: Ja, etwa Diskussionsformate, die schon sehr weit zurückliegen. Der Moderator Erich Böhme hat einmal Franz Schönhuber, den damaligen Vorsitzenden der rechtsgerichteten Republikaner, vorgeführt. Böhme war sehr gut vorbereitet und hat konsequent in die Wortblasen von Schönhuber reingestochen.
kreuzer: Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten wird wieder oft das Argument vorgebracht, die Neoliberalisierung, der Abbau sozialer Sicherungssysteme habe die Ängste vor dem Abstieg bei weiten Teilen der Arbeiter- und Mittelschichten in Gang gesetzt. Die Schweizer Forscherin Silja Häusermann hat in einem Interview dagegengehalten, dass sich die Anhänger rassistischer Bewegungen vor allem von kulturellen Veränderungen bedroht fühlen. Würden Sie dem zustimmen?
BEGRICH: Sie fragen danach, woher der Entfremdungsmechanismus in der Gesellschaft kommt. Ich glaube, beide Gründe sind wahr: Da ist einerseits der »angry old white man«, der sich von Identitätsdebatten nicht angesprochen fühlt. Wenn darin die Rede von gesellschaftlichen Minderheiten ist, hat er das Gefühl, es geht nicht mehr um ihn. Das ist der Moment des kulturellen Unbehagens. Und dann gibt es den realen und den imaginierten Abstieg von Gesellschaftsteilen, verbunden mit einem realen und imaginierten Repräsentationsdefizit.
kreuzer: Was davon ist in unserer Region ausschlaggebend?
BEGRICH: Ein Beispiel in Ostdeutschland ist die Entwertung von körperlicher Arbeit. Das hat mit der Schließung der ersten Kombinate angefangen. Da muss man erst einmal wahrnehmen, dass das so ist. Wenn es aber ein Defizit an Anerkennung für körperliche Arbeiten gibt, kann man nicht davon ausgehen, dass dann zugleich die Sensibilität für Minderheitenfragen steigt. Die Öffentlichkeit reagiert stattdessen mit diesem Sachsen-Bashing, nach dem Motto: So ist er eben, der Sachse – dumm, rassistisch, und Hochdeutsch kann er auch nicht. Das ist ein kolonialer Duktus, wenn man so redet. Mich interessiert nicht, wie ist der Sachse so ist, welches Bier er trinkt und so weiter. Die wichtige Frage ist, wie hat sich diese politische Kultur hier entwickelt? Ich halte von einer Kulturalisierierung der Widersprüche nichts.
kreuzer: Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Problemen hier und beispielsweise in den USA?
BEGRICH: In diesen Debatten spiegelt sich überall ein Gefälle zwischen den Metropolen und der Peripherie wieder. Auch in New York können sich die Leute nicht erklären, warum die Menschen in Milwaukee Donald Trump gewählt hat. Man wird dem Problem nicht gerecht, wenn man in Leipzig sagt, den Hinterwäldlern im Erzgebirge fehlt es an zivilisatorischen Kompetenzen.
kreuzer: Die Zentren müssten sich also mit der Peripherie auseinandersetzen?
BEGRICH: Ja, und zwar mit den tatsächlichen Gegebenheiten dort, nicht nur mit den Projektionen. Wenn man in Bautzen was ändern will, muss man die Arbeit des Jugendzentrums Steinhaus stärken und nicht aus dem fernen Berlin darüber schimpfen, wie dunkeldeutsch Bautzen sei. Das sind alles Diskurse, die wir in den Neunzigern schon mal geführt haben.
INTERVIEW: CLEMENS HAUG