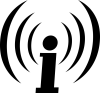Quelle:
Erstveröffentlicht:
11.04.2010
NZZ am Sonntag: Der Bund bewilligt nur
jedes sechste Asylgesuch, alle anderen Anträge lehnt er ab. Wie
verhindern Sie, dass auch künftig Tausende von Menschen ohne Chance auf
Asyl in die Schweiz kommen?
Alard du
Bois-Reymond: In erster Linie wollen wir das Problem mit den
Nigerianern lösen. Sie haben letztes Jahr mit fast 1800 Asylgesuchen am
meisten Anträge gestellt – 99,5 Prozent von ihnen ohne die geringste
Chance, in der Schweiz bleiben zu können. Sie kommen nicht als
Flüchtlinge hierher, sondern um illegale Geschäfte zu machen.
Warum kommen sie gerade in die Schweiz?
Weil
sie hier offensichtlich ein gutes Netz haben und die zweitgrösste
Kolonie von Landsleuten in Europa vorfinden. Ein grosser Teil von ihnen
driftet in die Kleinkriminalität ab oder betätigt sich im Drogenhandel.
Das ist eine traurige Tatsache.
Was wollen Sie dagegen unternehmen?
Wir
sind auf die Mithilfe der nigerianischen Behörden angewiesen und wollen
die gute Zusammenarbeit mit ihnen vertiefen. Wir brauchen ein neues
Rückübernahmeabkommen mit Nigeria. Es ist dabei denkbar, dass wir als
Gegenleistung Unterstützung bei der Sicherung der nigerianischen
Staatsgrenzen bieten. Eine internationale polizeiliche Zusammenarbeit
liegt im Interesse Nigerias, das den Ruf als Heimat vieler
Drogenhändler loswerden will.
Und was muss sich hier ändern?
Daneben
will ich auch die Prozesse in der Schweiz beschleunigen. Abgewiesene
Asylbewerber müssen schneller zurückgeführt werden. Zu diesem Zweck
setze ich eine Task-Force mit Mitarbeitern aus anderen Departementen
und aus den Kantonen ein. Beigezogen werden auch die Polizeien, weil es
nicht zuletzt um die Bekämpfung von Drogenhandel geht. Die Task-Force
soll bis im Sommer ein Massnahmenpaket präsentieren.
Wo sehen Sie Schwierigkeiten?
Ein
zentrales Problem ist, die Herkunft der Gesuchsteller zu eruieren und
sie anschliessend zurückzuschaffen. Faktisch kann ein abgewiesener
nigerianischer Asylbewerber zurzeit ein Jahr in der Schweiz bleiben.
Sein Ziel ist es ja auch, möglichst lange hier tätig sein zu können.
Mit Ihren Massnahmen gegen Nigerianer stigmatisieren Sie eine einzelne Gruppe von Asylbewerbern.
Ich
habe gerade von Asylbewerbern gesprochen, die krassen Missbrauch
betreiben. Man muss die einzelnen Gruppen der Gesuchsteller
differenziert betrachten. Bei den Asylbewerbern aus Eritrea
beispielsweise geht es um Menschen, die in ihrer Heimat mit teils
unerträglichen Bedingungen konfrontiert sind. Das ist eine ganz andere
Ausgangslage als bei den Nigerianern. Und wiederum anders verhält es
sich mit Asylsuchenden aus Somalia oder Sri Lanka.
Werden
Sie gegen nigerianische Asylbewerber auch deshalb aktiv, weil das
Parlament gerade die Ausschaffungsinitiative der SVP behandelt?
Nein,
das hat damit nichts zu tun. Das Problem mit den Nigerianern ist real
und soll nicht tabuisiert werden – im Interesse aller Asylbewerber, die
gute Gründe haben, in die Schweiz zu kommen. Heute spricht ja kaum
jemand von echten Flüchtlingen. Mit Asylbewerbern meint man oft
Scheinasylanten. Im Asylwesen ist das Randthema des Missbrauchs
dominant geworden – wie in der Invalidenversicherung das Randthema der
Scheininvaliden.
Wie wollen Sie Asylbewerber schützen, die tatsächlich aus ihrer Heimat flüchten müssen?
Damit
die humanitäre Tradition der Schweiz nicht verloren geht und nicht von
Debatten über Asylmissbrauch überdeckt wird, müssen wir streng sein mit
denjenigen, die das System austricksen wollen. Es ist eine Tatsache,
dass sich gewisse nigerianische Asylbewerber über die Naivität der
Schweizer lustig machen und die Schwächen des Asylverfahrens ausnutzen.
Für mich ist klar: Wir sind zu attraktiv als Asyl-Land für
missbräuchliche Gesuchsteller. Die Schweiz lässt diesen zu viel Zeit,
hier krumme Geschäfte zu machen. Allerdings braucht es Zeit, um das zu
ändern. Deshalb rechne ich auch dieses Jahr mit etwa 16 000
Asylgesuchen.
Ein nigerianischer Asylbewerber ist kürzlich bei einer Zwangsausschaffung gestorben.
Die
Aufklärung des tragischen Vorfalls liegt auch in unserem Interesse.
Parallel zu den Untersuchungen der Zürcher Staatsanwaltschaft sind wir
mit den involvierten kantonalen Behörden im Gespräch und prüfen
gemeinsam, ob bei den Abläufen Veränderungen nötig sind. So können wir
wieder Sonderflüge für abgewiesene Asylbewerber durchführen, sobald die
Untersuchungsergebnisse vorliegen.
Neben
dem Asylwesen ist die Integration, vor allem die Integration von
Muslimen, eine Aufgabe des Bundesamts für Migration. Wie soll diese
Integration aussehen?
Es ist zu
früh, über konkrete Massnahmen zu sprechen. Sicher aber ist, dass das
Thema wichtig ist und in den richtigen Relationen gesehen wird. Von den
rund 350 000 Musliminnen und Muslimen in der Schweiz praktizieren nur
rund 50 000 ihren Glauben. Und nur rund 10 000 Musliminnen und Muslime
sind strenggläubig. Vor allem diesen müssen wir klarmachen, dass in der
Schweiz unsere Werte und unsere Gesetze gelten.
Gegenwärtig
sorgen vor allem junge Schweizer für Schlagzeilen, die zum Islam
konvertiert sind und sich im sogenannten Islamischen Zentralrat
organisiert haben.
Diese
Islam-Konvertiten gehören zu einer Gruppe, bei der
Integrationsmassnahmen keinen Erfolg haben. Der Grund ist einfach: Sie
sind bereits integriert, und zwar sowohl sozial als auch ökonomisch.
Allerdings sind sie Dialog-resistent. Einzelne von ihnen wollen eine
radikal andere Gesellschaft, einen Gegenentwurf zur bestehenden
Ordnung. Darin kann, wie Fälle aus Deutschland oder England zeigen, ein
Nährboden für potenzielle Terroristen liegen, vergleichbar mit den
früheren RAF-Terroristen in Deutschland. Auch sie waren integriert,
strebten aber eine radikal andere Gesellschaft an. Solche
Islam-Konvertiten wären für mich keine Folge mangelnder Integration,
sondern schlicht ein Sicherheitsproblem für unser Land.
Und wie soll der Staat dieses Sicherheitsproblem lösen?
Mit
Mitteln der Polizei und der Nachrichtendienste. In demjenigen Moment,
in dem die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, muss der Staat
eingreifen. Es gilt die geltenden Gesetze anzuwenden und durchzusetzen.
Es
gibt nicht nur Islam-Konvertiten, sondern auch ausländische Muslime,
die in die Schweiz immigriert sind und strenggläubig, ja radikal sind.
Das
ist nicht auszuschliessen. Um einer möglichen Radikalisierung von
Migranten entgegenzutreten, müssen wir für eine schnelle und gute
Integration dieser Menschen sorgen.
Braucht
es für die schnelle und gute Integration, die Sie erwähnen, mehr
Entgegenkommen der Schweizer? Oder mehr Anpassung der Migranten?
Natürlich
braucht es immer beides. Aber es gibt Dinge, die bei einer Integration
nicht diskutierbar sind. Um beim Beispiel der Muslime zu bleiben: Die
Scharia darf in der Schweiz in keinem Fall zur Anwendung kommen. Und
zwar auch nicht in Bereichen, die durch das Schweizer Recht nicht
abgedeckt sind.
Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf, Ihre politische Vorgesetzte, hat auch schon laut über ein Burka-Verbot nachgedacht.
Solange
es in der Schweiz faktisch keine Burka-Trägerinnen gibt, stellt sich
die Frage eines Verbots nicht. Sollte das einmal anders sein, sähe ich
allerdings durchaus Handlungsbedarf: Das Burka-Tragen verstösst gegen
unsere Werte. Es verletzt den Grundwert, dass Mann und Frau
gleichwertige Menschen sind.
Mit dieser Argumentation müsste in der Schweiz auch Kopftuch-Tragen verboten werden.
Das
Bundesgericht hat bereits klar entschieden, dass das Tragen von
Kopftüchern in öffentlichen Ämtern unzulässig, hingegen im privaten
Bereich zulässig ist. Ein ähnliches Beispiel ist der Schwimmunterricht.
Wenn eine Schulklasse schwimmen geht, so haben alle Kinder dem
Schwimmunterricht zu folgen. Es gilt, unser Recht zu respektieren und
das geltende Recht durchzusetzen.
Interview: Lukas Häuptli, Andreas
Schmid