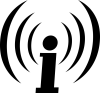Das Thema beherrscht alles in Deutschland. Die Flüchtlingspolitik bestimmt die Nachrichten, die persönlichen Gespräche – und den Tagesablauf der Bundeskanzlerin. Gestern war ein Tag, der zwangsläufig zu der Frage führt: Wie lange noch hält Angela Merkel ihren Kurs? Hat sie einen Plan B?
Es beginnt mit einer ungemütlichen Kabinettssitzung am Morgen in Berlin. Mit am Tisch: Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Der CSU-Mann steht in dieser Woche für den Verlust der Kabinettsdisziplin. Statt den Flüchtlingen immer nur zuzulächeln, müsse ein Kurs der Zuzugsbegrenzung auch mit nationalen Maßnahmen her, fordert der Minister offen. Angela Merkel kommentiert Dobrindts Herausforderung mit keinem Wort.
Kaum ist die Kabinettssitzung in Berlin beendet, kommen neue Meldungen aus Wien: Österreich beschließt eine Obergrenze für Flüchtlinge. Die österreichische Regierung wird in diesem Jahr nur noch 37 500 Asylbewerber aufnehmen. Bis 2019 sollen es insgesamt maximal 127 500 sein – ein Richtwert, der sich jährlich an maximal 1,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung orientiert. Entlang der Balkan-Fluchtlinie steht nun nur noch Deutschland ohne Kontingent und Höchstbegrenzung da.
Am Mittag meldet sich der längere Zeit abgetauchte Bundespräsident Joachim Gauck von Davos aus zu Wort mit einer Rede, die elegant und passgenau die Bedeutung Europas, die Integrationsbereitschaft der Nationen und das Werben der Kanzlerin für eine kontinentale Flüchtlingsarbeit auf einen Nenner bringt.
Am Abend dann der Ausflug der Kanzlerin ins Wildbad Kreuth. Es geht den versammelten CSU-Politikern um nicht weniger als eine Kehrtwende der Kanzlerin. Ihre einzige Botschaft: „Wir schaffen das nicht mehr.“ Mit den CSU-Parlamentariern zusammen hat inzwischen rund ein Drittel der Mitglieder der CDU/CSU-Bundestagsfraktion brieflich zu Protokoll gegeben, dass sich beim Flüchtlingszuzug dringend etwas ändern müsse.
Die Kanzlerin weiß, dass ihr die Zeit davonlaufen könnte. Am 13. März wird in drei Bundesländern gewählt. Dreimal erwartet die rechtspopulistische AfD ein zweistelliges Wahlergebnis. Für die CSU, die ihre bayerische und nationale Stärke daraus zieht, dass sich rechts neben ihr keine demokratisch legitimierte Kraft breitmacht, ginge das an die Substanz.
Einer, der früher mal Bundesminister unter Merkel war, stellte im Lauf des Tages eine These in den Raum, die die ganze parteipolitische Dramatik der Flüchtlingsdebatte auf den Punkt bringen könnte: Womöglich überlebten das weder Horst Seehofer noch Angela Merkel als Parteivorsitzende, sagt Hans-Peter Friedrich. Wenn es dumm liefe, käme auch noch Sigmar Gabriel zu den Verlierern hinzu, weil es dem SPD-Vorsitzenden partout nicht gelingt, die Streitschwäche der Union in positive Effekte für seine Partei umzumünzen. Und eigentlich ist, auch mit der AfD neu im Konzert, die Aussicht fast ganz geschwunden, dass sich demnächst in Deutschlands Parlamenten „linke“ Mehrheiten bilden könnten. Intern argumentiert die SPD mittlerweile in Sachen Flüchtlingsobergrenze fast so wie die CSU: Seehofer hält höchstens 200 000 unter Integrationsgesichtspunkten für machbar, Sigmar Gabriel und Fraktionschef Thomas Oppermann setzen die Zahl intern bei 400 000 bis 500 000 an. Gabriel wird nach den nächsten Landtagswahlen seiner Partei erklären müssen, wie es parteipolitisch weitergehen soll.
Seehofer, der inzwischen alt und kränkelnd wirkt, steht schon jetzt mittendrin im Nachfolgestreit. Markus Söder, der kräftigste der CSU-Erbkandidaten, hätte lieber heute als morgen den Wechsel. Seehofer aber will nicht als Geschwächter übergeben. Doch ihm läuft die Zeit für eine Konfliktlösung mindestens so schnell davon wie der Vorsitzenden der Unionsschwester. „Angela, wir wollen es lösen, mit dir als Bundeskanzlerin. Aber wir wollen es lösen“, sagte Seehofer schon vor zwei Wochen im Beisein der Kanzlerin. Es ist ein vergifteter Wunsch. Denn intern geht die CSU davon aus, dass sich „bis März“ etwas ändern muss. Dann wollen die Söders in der CSU die Abrechnung.
Angela Merkel hat schon einmal bewiesen, dass sie kühl kalkulierend auch eherne Grundsätze aufgibt, wenn äußere Ereignisse ihr signalisieren, das Volk hat in seiner Mehrheit eine neue Erwartung an die Politik. Die Atomkatastrophe von Fukushima war für sie Anlass genug, blitzschnell frühere Positionen zur Atomkraft aufzugeben. Überraschend für die eigene Klientel stand sie plötzlich an der Spitze einer Bewegung: „Atomkraft – Nein danke“.
Auch damals standen Landtagswahlen an, sie standen ganz unter dem Fukushima-Effekt. Jetzt würde Merkel eine Korrektur deutlich schwerer fallen, weil der Kurs in der Flüchtlingspolitik unmittelbar mit ihrem Namen verbunden ist. Nationale Probleme, ob nach den Kölner Übergriffen oder nach CSU-Provokationen, werden garantiert nicht zum Umdenken der Chefin führen, sagen ihre engsten Ratgeber im Kanzleramt. Die Kanzlerin wirke nach wie vor entschlossen, für ihre Linie zu kämpfen. Wenn sich rundherum die Ausgangsbedingungen geändert hätten, müsse man „neu nachdenken“. Das habe dann nichts mit „Gesichtswahrung“ zu tun, allenfalls mit Pragmatismus.
Am Tag, als Österreich seine Obergrenze für die nächsten drei Jahre festzurrte, packte einer von Merkels Mitstreitern dann doch eine überraschende Variante aus: Deutschland müsse ein Kontingent festlegen, mit dem ein legaler Weg nach Europa ermöglicht werde – für eine begrenzte Zahl von Menschen. Parallel dazu könne man dann und im Lichte der österreichischen Festlegungen realistisch das Flüchtlingsthema neu anpacken. Die Linie dafür hat der Bundespräsident gestern in Davos eindrücklich beschrieben. Es gebe eine Art gefühlter Obergrenze der Belastbarkeit für jede Gesellschaft – auch für die deutsche.
Bei der CSU sagte Merkel gestern Abend: „Worin wir uns einig sind, ist, dass wir die Zahl der ankommenden Flüchtlinge spürbar und nachhaltig reduzieren wollen.“ Von Obergrenzen oder Grenzschließungen im großen Stil aber will sie weiter nicht reden.
Da gibt es am Ende eines langen Tages wenigstens noch Beifall aus der Wirtschaft: Geschlossene Grenzen innerhalb der Europäischen Union könnten die deutsche Wirtschaft viele Milliarden Euro kosten. DIHK-Geschäftsführer Martin Wansleben malt da schon das nächste Krisenszenario aus: „Durch Staus und Wartezeiten, zusätzliche Bürokratie oder zum Beispiel die Umstellung von Just-in-time-Lieferung auf deutlich teurere Lagerhaltung können sich die Kosten für die deutsche Wirtschaft schnell auf 10 Milliarden Euro pro Jahr summieren.“